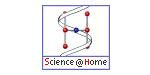Kopie von `Science at home`
Die Wörterliste gibt es nicht mehr oder die Website ist nicht (mehr) online.
Nachstehend finden Sie eine Kopie der Informationen. Eventuell ist die Information nicht mehr aktuell.
Wir weisen Sie darauf hin, bei der Beurteilung der Ergebnisse kritisch zu sein.
Kategorie: Allgemeines > Science
Datum & Land: 13/05/2009, De.
Wörter: 561
Anämie
[griech. an 'nicht' und haima 'Blut'] Verminderung der Konzentration der roten Blutkörperchen. Blutarmut.
Anästhetika
[griech. a 'nicht' und aisthesis 'Wahrnehmung'] (Singular: Anästhetikum) Schmerz- und Betäubungsmittel. Im Gegensatz zum Analgetikum wird bei der Gabe von Anästhetika auch die sensorische Wahrnehmung beeinflusst.
Antiteilchen
Ein Elementarteilchen mit entgegengesetzten Eigenschaften eines 'normalen' Teilchens in der uns umgebenden Materie. Teilchen und Antiteilchen haben identische Massen, Lebensdauer, Spin und Isospin, während die Ladung dem eines normalen Teilchens entgegengesetzt ist. Wenn Teilchen und Antiteilchen aufeinander treffen, zerstrahlen sie in Energie (Paa...
Antipyretika
[griech. anti 'gegen' und pyr 'Feuer'] veraltet auch Febrifugum. Fieberstillende Arzneistoffe.
Antimykotika
[griech. anti 'gegen' und mykes 'Pilz'] Arzneistoffe zur Behandlung von Pilzinfektionen.
Antiphlogistika
[griech. anti 'gegen' und phlogosis 'Entzündung'] Entzündungs- und schmerzhemmende Mittel.
Antigene
[aus dem engl. Antibody generating] Körperfremde Substanz, die beim Eindringen in den Organismus eine Immunreaktion hervorruft und zur Bildung der Antikörper führt.
Antikörper
auch Immunglobulin. Vom Organismus in der Blutbahn gebildeten, proteinhaltigen Abwehrstoffe, die als Reaktion auf eingedrungene Fremdstoffe (Antigene) gebildet werden.
Antifungizide
siehe: Fungizid
Antidot
[griech. andidoto 'das dagegen Gegebene'] auch Antitoxin. Gegenmittel, Gegengift. Ein Medikament, das die Wirkung eines Giftstoffs aufhebt oder lindert.
Anthelminthikum
[griech. helmins 'Wurm'] Mittel Gegen Wurmbefall (Helminthiasis).
Anthrakose
[griech. anthrax 'Kohle'] Ablagerungen von kohlehaltigen Stäuben in der Lunge und in den Lungenlymphknoten. Kohlenstaublunge.
Anthropologie
[vom griech. ánthropos 'Mensch' und logos 'Lehre'] Die Wissenschaft vom Menschen, seiner Entwicklung (Evolution) und Kultur. Nicht zu verwechseln mit der ideologisch-pseudowissenschaftlichen Auslegung Anthroposophie. A Altruismus E Ethnologie Etymologie L Linguistik P Paläoanthropologie Paläolinguistik
Anthropozoonose
[griech. anthropos 'Mensch', zoon 'Tier' und nosos 'Krankheit'] Infektionskrankheiten, die von Menschen auf Tiere übertragen werden, ohne dass der Wirt selbst daran erkrankt. Vgl. Zooanthroponose
Antibiotikum
[griech. anti 'gegen' und bios 'Leben'] Ein Medikament gegen Infektionskrankheiten, verursacht durch Bakterien und Protozoen. Wird aus Stoffwechselprodukten von Mikroorganismen wie Schimmelpilzen, Strahlenpilzen und Bazillen hergestellt. Die Entdeckung des ersten Antibiotikums (Penicillin) geht auf den britisch...
Anoxie
[griech. an 'nicht' und oxys 'sauer'] Fehlen von Sauerstoff im Körpergewebe aerober Lebewesen. Die Sauerstoffunterversorgung heißt Hypoxie.
Anorexie
[griech. a(n) 'Abwesenheit' und orexe 'Appetit'] Appetitlosigkeit. Tritt infolge von Infektionskrankheiten, Drogenmissbrauchs oder psychischen Störungen auf.
Andrologie
[griech. andro 'Mann' und logos 'Lehre'] Männerheilkunde. Medizinische Fachrichtung, die sich mit der Diagnose und Behandlung der geschlechtsspezifischen Krankheiten des Mannes beschäftigt. Vgl. Gynäkologie
Angiom
Gutartige Geschwulst der Gefäßsysteme mit Neubildung von Blutgefäßen (Hämangiom) oder Lymphgefäßen (Lymphangiom).
androgyn
[griech. andros 'Mann' und gynaikos 'Frau'] Beide Geschlechtsmerkmale (männlich und weiblich) in sich vereinigend.
Anamnese
[griech. anamnesis 'Erinnerung'] Von einem Arzt durchgeführte diagnostische Befragung zu der Vorgeschichte des Patienten zwecks der Feststellung von Ursachen der Pathogenese einer Krankheit.
Analgesie
[griech. a 'nicht' und algos 'Schmerz'] Ausschalten der Schmerzempfindlichkeit. Die schmerzstillende Mittel werden als Analgetika bezeichnet.
Analgetika
[griech. a 'nicht' und algos 'Schmerz'] (Singular Analgetikum) Schmerzmittel. Analgetische Wirkstoffe verringern die Schmerzempfindung, ohne jedoch (idealerweise) die Wahrnehmung des Patienten zu beeinflussen. siehe auch: Anästhetika
anaerob
Ohne Sauerstoff auskommend. Organismen, die keinen Sauerstoff zum Leben benötigen, nennt man Anaerobier (Anaerobionten). Z.B. Darmbakterien, Bandwürmer. Ggs. aerob
Anabiose
[vom griech. ana 'wieder' und bios 'Leben'] Die Fähigkeit von einigen (niederen) Organismen bei ungünstigen Lebensbedingungen in einen nahezu leblosen Zustand zu verfallen.
amorph
[griech. a 'nicht' und morphos 'Gestalt'] formlos, gestaltlos. Gegensatz: kristallin.
Altruismus
Selbstlosigkeit. Soziales Verhalten von Menschen und einigen anderen höheren Säugetieren ohne scheinbaren Eigennutz. Das Gegenteil von Altruismus ist Egoismus.
Amenorrhö
Aussetzen der Menstruation für eine längere Zeit ohne eine vorhandene Schwangerschaft. Amenorrhoe ist ein Symptom für etwaige anatomische, biochemische, genetische, physiologische oder psychische Störungen.
Allergie
Eine falsche oder überempfindliche Reaktion des Immunsystems auf in der Regel harmlose Fremdstoffe wie Pollen, Haare, Hautschuppen, Pilzsporen, Ausscheidungen der Hausstaubmilben, Kosmetika, Waschmittel, Medikamente usw. Der Körper reagiert auf die Allergene mit Bildung von Antikörpern und Entzündungsanzeichen an Haut und Schleim...
Allel
Merkmalsausprägungen eines Gens durch natürliche Mutationen. Die Allele unterscheiden sich geringfügig in der Basensequenz der DNA, was zur Variation der Gene führt. So kann ein Gen, das z.B. für weiße und rote Blütenfarbe oder blaue und grüne Augen verantwortlich ist, in zwei oder mehr verschiedenen Ausprägungsformen vorkommen. Es handelt sich hie...
Allantois
[griech. Die Wurstförmige] Rudimentäre Harnblase aller Wirbeltiere während der Embryophase in Form einer Ausstülpung des Darms. Sie entsteht an der Bauchwand des hinteren Darmabschnitts und dient den Vogelembryos auch als Atemorgan. Beim Menschen entwickelt sie sich später zur Nabelschnur.
Alkalose
(auch Basifizierung) Untersäuerung des Körpers bei einem Blut-pH-Wert > 7,45. Man unterscheidet zwischen der respiratorischen Alkalose (Hyperventilation) oder der metabolischen Alkalose (stoffwechselbedingt, z.B. bei Nierenleiden). Nachweis über Blutgasanalyse. siehe auch: Azidose
Algurie
[griech. algos 'Schmerz' und ouron 'Harn'] Schmerzhafte Urinausscheidung. In der Regel sind die Schmerzen symptomatisch für einen Harnwegsinfekt, Blasensteine oder eine Prostataentzündung (Prostatitis). Siehe auch: -Hämaturie -Pollakisurie -Strangurie
Agglomerat
[lat. agglomerare 'zusammenballen'] Ansammlung vulkanischen Auswurfs aus groben, kantigen Gesteinsbrocken.
Albedo
Rückstrahlvermögen von nicht selbst leuchtenden Himmelskörpern (Planeten, Monde, Asteroide). Wird im Verhältnis zu der einfallenden und der reflektierten Lichtmenge angegeben.
Aerostatik
Eine Lehre, die sich mit ruhenden, strömungsfreien Gasen befasst. Ggs: Aerodynamik
Affinität
[aus dem griech. 'Verwandtschaft'] Die Tendenz von Atomen, miteinander Bindungen einzugehen. Reaktionsfreudigkeit von Stoffen.
Aerodynamik
Teil der Strömungslehre (Fluiddynamik). Befasst sich mit Strömungsverhalten von Gasen (v.a. Luft) gegenüber festen Körpern und den Kräften, die auf diese Körper einwirken. Ggs: Aerostatik
Aeronomie
Teildisziplin der Meteorologie, die sich mit der Erforschung der oberen Luftschichten befasst.
Aerobiologie
[vom griech. aero 'Luft', 'Gas', bios 'Leben' und logos 'Lehre'] Teilgebiet der Biologie. Befasst sich mit Mikroorganismen in der Atmosphäre.
aerob
Sauerstoff benötigend. Organismen, die auf Sauerstoff angewiesen sind, nennt man Aerobier (Aerobionten). Ggs. anaerob
Aedeagus
[griech. aedes 'Haus' und ágere 'führen'] Penisartige Organ bei Insekten und Gliederfüßern. Besteht aus einer Chitinröhre, die vor der Begattung teleskopartig ausgefahren wird.
Adsorption
[vom lat. adsorbere 'festhalten'] Physikalische Aufnahme und Bindung von Gasen und Dämpfen an der Oberfläche eines festen Stoffes. Die bekanntesten Adsorptionsmittel sind z.B. Aktivkohle oder Kieselsäuregel.
Adrenalin
(v. lat. ad zu und ren Niere) Im Nebennierenmark produzierter Stresshormon, der den Stoffwechsel in Gefahrensituationen mobilisiert. Er erhöht die Herzfrequenz und den Blutdruck und mobilisiert die in Form von Fett oder Glykolen gespeicherten Energiereserven des Körpers, so dass die Belastbarkeit und Reaktionsf...
Adipsie
[griech. a 'ohne' und dipsa 'Durst'] Fehlen des Durstgefühls. Adipsie ist nicht lebensbedrohlich, kann aber zur Exsikkose führen. siehe auch: Polydipsie
Adhäsion
Aneinanderhaftung zweier Stoffe oder Körper unterschiedlicher Zusammensetzung aufgrund von molekularen Anziehungskräften. Die Adhäsionskräfte sorgen z.B. dafür, dass sich Wassertröpfchen am Glas haften.
Adipozyten
[griech. adeps 'Fett' und griech. kytos 'Zelle'] Fettzellen des Körpergewebes. Man unterscheidet zwischen weißem (univakuoläre Adipozyten) und braunem Fettgewebe (plurivakuoläre Adipozyten). Die letzteren dienen vor allem der Thermoregulation des Organismus, wie sie vermehr...
Adenom
Gutartige Geschwulst aus Drüsen- oder Schleimhautgewebe. Polyp.
Adermin
Vitamin B6. siehe: Vitamine (Tabelle)
Adaptive Optik
Eine mechanisch-elektronische Korrektur für Großteleskope zur Behebung atmosphärischer Störungen (Seeing).
Absorption
[lat. absorbere 'aufsaugen'] 1. Physik: Aufnahme der Strahlung oder Schallwellen durch ein anderes Medium. 2. Chemie: Aufnahme von Stoffen durch andere.
Adaption
[lat. adaptare 'anpassen'] auch Adaptation. Unter der Adaption versteht man in der Astronomie die allmähliche Anpassung des Auges an die Dunkelheit. Die Lichtempfindlichkeit des Auges hängt von der Menge des Proteins Rhodopsin ab, das bei hellem Licht abgebaut wird. Damit sich das Auge an die Dunkelheit gewöhnt...
absoluter Nullpunkt
T0, theoretisch tiefste mögliche Temperatur, Anfangspunkt der Temperaturskala nach Kelvin. Null Kelvin (0K) hat auf der Celsiusskala -273,15 °C.
Abrachius
[lat. brachium 'Arm'] Fehlbildung bei einem Neugeborenen, dem ein oder beide Arme fehlen.
Abplattung
Die Verformung von Himmelskörpern infolge der auf sie einwirkenden Fliehkraft, bewirkt durch deren Rotation. Hängt von der Dichte und der Rotationsgeschwindigkeit des Objekts ab. Die Planeten mit der stärksten Abplattung in unserem Sonnensystem sind Jupiter (1:15) und Saturn (1:10). Die Erde hat eine Abplattung von 1:298.
Aberration
Optischer Abbildungsfehler; eine scheinbare Ortsveränderung aufgrund der Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit.
Ablation
Das Abschmelzen von Schnee und Eis, insbesondere in Bezug auf die Gletscher.
Abendstern
Eine volkstümliche Bezeichnung für den Planeten Venus, weil er wegen seiner Sonnennähe stets kurz nach Sonnenuntergang- bzw. vor Sonnenaufgang (Morgenstern) zu sehen ist.
Abdomen
[lat.] Unterleib (Med.); Hinterleib eines Gliederfüßlers (Zoologie).
Abendpunkt
auch Westpunkt. Der Punkt am Horizont, in dem der Himmelsäquator zur Zeit des Frühlings- bzw. Herbstanfangs (Äquinoktium oder Tagundnachtgleiche) den Horizont schneidet und an dem die Sonne untergeht.
Abbe, Ernst
(* 23.01.1840; † 14.01.1905) dt. Physiker, Mathematiker, Astronom und Optiker. Bekannt insbesondere durch seine herausragende Leistungen auf den Gebieten Gerätebau und Optik. Auf Abbe gehen die Grundlagen der modernen Optik zurück.