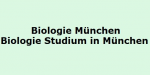Kopie von `Biologie München - Biologie Lexikon`
Die Wörterliste gibt es nicht mehr oder die Website ist nicht (mehr) online.
Nachstehend finden Sie eine Kopie der Informationen. Eventuell ist die Information nicht mehr aktuell.
Wir weisen Sie darauf hin, bei der Beurteilung der Ergebnisse kritisch zu sein.
Kategorie: Pflanzen und Tiere > Biologie
Datum & Land: 20/05/2009, De.
Wörter: 295
Osteoporose
Knochenschwund. Schwund der Gerüstsubstanz der Knochen, die immer poröser werden. Die Osteoporose ist eine häufige Erkrankung im höheren Lebensalter, wobei der Hormonmangel (bei der Frau Östrogene, beim Mann Testosteron) eine wesentliche Rolle spielt.
Z-Chromosom
bei Organismen mit weiblicher Heterogametie das in beiden Geschlechtern vorhandene – somit dem X bei männl. Heterogametie entsprechende – Geschlechtschromosom
Zäkokolon
der Blinddarm (Caecum) samt angrenzendem Colon ascendens.
Acidität
Säuregrad
Gendrift
ist eine Veränderung der Genfrequenzen als Folge der wahrscheinlichen Abweichung vom erwarteten Ergebnis. Man kennt die 2 Formen: Falschenhals- und Gründer-Gendrift.
Zykline
Proteine, die bei der Kontrolle der Zellteilung eine wichtige Rolle spielen; ihre Konzentration steigt und fällt im Rhythmus der Zellteilungen
Zytokinine
Signalsubstanzen wie z. B Interleukin mit denen die Leukozyten untereinander kommunizieren können. Man kennt derzeit über 20 Substanzen. Sie rufen u. a. Fieber hervor. Cytokininrezeptoren befinden sich auf der Zelloberfläche.
Zytosin
Pyrimidinbase; Vorstufe der Nukleoside Cytidin und Desoxycytidin, die Bausteine der Genmoleküle RNA und DNA sind.
Zygote
Befruchtete Eizelle, entsteht aus der Fusion eines männlichen und eines weiblichen Gameten. Durch mitotische Teilung entsteht ein Embryo.
Zytozentrum
die aus Zentriol u. Zentroplasma bestehende Funktionseinheit der Zelle.
Zytosol
Unter Cytosol versteht man den Zellsaft, in dem bei Eukaryonten die Organellen schwimmen.
Zytoplasma
Grundsubstanz des Protoplasmas. Das Protoplasma ist die Gesamtheit der lebenden Bestandteile der Zelle, bestehend aus dem Grund- oder Zytoplasma und den Organellen.
Zellatmung
Stoffwechselvorgang bei dem während der Glykolyse, der oxidativen Decarboxylierung dem Citratzyklus (Zitronensäurezyklus) und der Atmungskette Sauerstoff (O2) verbraucht wird, CO2, Wasser und Energie entsteht.
Zentrosom
das Mikrozentrum, bestehend aus Zentriol u. Zentroplasma.
Zentroplasma
in der Interphase der Tierzelle die die beiden Zentriolen umschließende hellere Plasmazone.
Zentriol
ein sich in der Interphase spontan verdoppelndes (= autoreduplikatives) zylinderförmiges, meist zweiteiliges (= Diplosom), aus Mikrotubuli bestehendes Zellorganell im Zentroplasma (mit dem zusammen es das Zytozentrum bzw. Zentrosom bildet).
Zellmembran
Dünne Schicht, welche die gesamte Zelle als eine Art ‚Haut' umschließt. Sie besitzt eine sogenannte ‚Sandwich'-Struktur und folgt damit der allgemeinen Struktur von Membranen. Die Zellmembran erfüllt verschiedene Aufgaben: 1. Sie stellt eine passive Diffusionsbarriere dar 2. Sie führt passiven und aktiven Transport durch sowie Endo-/Exozytose 3. Z...
Zellen
(lat.: cella = Kämmerchen) Kleinste selbstständig lebensfähige, biologische Einheit. Alle Lebewesen bestehen aus Zellen. Die einfachsten Lebewesen bestehen aus nur einer einzigen Zelle. Höher entwickelte Lebewesen wie der Mensch sind aus einer grossen Anzahl von Zellen aufgebaut.
Zellrezeptor
Molekül auf der Oberfläche von Zellen, das gezielt bestimmte Substanzen (z.B. Beispiel Hormone oder Botenstoffe) einfängt. Solche Substanzen werden vielfach mit einem Schlüssel verglichen, der genau in das Schloss des Rezeptors passt. Sperrt die Schlüsselsubstanz, so verändert der Rezeptor seine Raumstruktur und löst dadurch Reaktionen im Inneren ...
Zellzyklus
Gesamtheit der Vorgänge zwischen dem Abschluß einer Mitose und dem Abschluß der darauffolgenden Meiose einer Zelle.
Zellkern
Teil einer Zelle, der die Chromosomen und damit nahezu die gesamte Erbinformation eines Menschen enthält (ein winziger Teil der Erbinformation ist in den Mitochondrien gespeichert).
Zellwand
Bei Pflanzenzellen Schicht aus Cellulose oder Holz um die Zellmembran.
Zentromer
zentrales Element des Chromosoms
Zellorganellen
subzelluläre, von Membranen umschlossene, funktionelle Untereinheiten der Zellen.
Zellulose
Die aus Glucose-Ketten bestehende Biopolymer Zellulose ist zusammen mit Lignin, Hemicellulose und Pektinen einer der Hauptbestandteile pflanzlicher Zellwände.
Xenoantigen
artfremdes Antigen bzw. speziesverschiedenes Antigen.
Yersinia
kurze, gramnegative Stäbchenbakterien der Familie Enterobacteriaceae.
Y-Chromosom
as bei genotypisch getrenntgeschlechtl., diploiden Organismen mit männl. Heterogametie (z.B. Mensch) sowie bei genotypisch getrenntgeschlechtl. haploiden Organismen nur im weibl. Geschlecht vorhandene Gonosom.
Xanthen
zu Xanthon oxidierbare heterozykl. Verbindung (s. Formel). Grundsubstanz anticholinergisch wirksamer Pharmaka u. der Xanthenfarbstoffe (Fluorescein, Eosin- u. Rhodaminfarbstoffe, Pyronine etc.).
Ureter
Ausführgang des Metanephros
Vakuole
Die Vakuole ist in Pflanzenzellen ein großer, flüssigkeitsgefüllter Hohlraum, der den größten Teil des Pflanzenzellvolumens einnimmt.
Ventrikel
Hohlraum im Herzen bzw. im Gehirn
visceral
den Bereich der Eingeweide betreffend. Auch gebraucht, um die Bereiche ventral des Schädels (Pharynxregion = Rachen, Kehlkopfbereich) zu kennzeichnen
Wildtyp
In der Natur auftretende genetische Normalform.
Wirt
Organismus, der von einem Parasiten befallen wird.
Tuberositas
lat. Rau(h)igkeit, nennt man in der Anatomie einen Knochenvorsprung mit rauer Oberfläche, an dem häufig die Sehne eines Muskels ansetzt.
Unguis
das feste, äußere oder laterale Material eines Hufes, einer Klaue oder eines Nagels
Trichome
Ein- oder mehrzellige Auswüchse der Epidermis einer Pflanze; auch Pflanzenhaare.
Trochlea
rollenförmige Gelenkknochen oder Gelenkknorpel
Transkription
Umschreiben der DNA in RNA. Wichtigstes Enzym hierfür ist die RNA-Polymerase Bei diesem Vorgang wird die normalerweise verdrillte DNA-Strickleiter teilweise entspiralisiert. Die beiden Stränge der DNA-Strickleiter, die normalerweise über jeweils zwei Gen-Buchstaben als Sprossen verbunden sind, werden getrennt, so dass zwei Einzel-Ketten von Gen-Bu...
Trophoblast
Hülle der menschlichen Keimblase.
Translation
`Übersetzung†œ der in der Nucleotidsequenz der mRNS gegebenen genet. Information in die Aminosäuren-Sequenz eines genspezif. Polypeptids bei der Eiweißbiosynthese (dort Schema). Enzymat. Verknüpfung der Aminosäuren mit jeweils spezif., durch ein best. Basen-Triplett (`Anticodon†œ) ausgezeichneten tRNS-Formen zu ebenso vielen Aminoacyl-tRNS-Formen, d...
Tracheenatmung
Atmung von Insekten, Tausendfüßer und vieler Spinnentiere durch Tracheen, verzweigte, mit einer Cuticula und Spiralen aus Chitin ausgesteifte Luftröhren.
totipotent
allseitige Entwicklungsfähigkeit. Die befruchtete Eizelle, die Zygote, trägt die Entwicklungsmöglichkeiten zu allen Zelltypen in sich, denn alle gehen aus ihr hervor. Aber nicht nur die Zygote ist totipotent. Bis zum 8-Zell-Stadium ist jede Zelle des Embryos totipotent und das heißt, dass - nach Abspaltung aus dem Zellverband - sich aus dieser Zel...
Tocopherole
Vitamin E; die bedeutendste in der Natur vorkommende Verbindung mit Vit. E-Aktivität ist das a-Tocopherol. Es besitzt 3 Chiralitätszentren (2, 4, 8), an denen die Methylgruppen in R-Konfiguration stehen. Das natürlich vorkommende a-Tocopherol ist meist begleitet von geringen Mengen b-, g- und d-Tocopherol, die sich durch Zahl und Position der Meth...
Tierzelle
Aufbau einer Tierzelle: Zellmembran, Mitochondrium, endoplasmatisches Retikulum, Kernhülle ,Zellplasma, Dictyosom (Golgi-Apparat), rauhes endoplasmatisches Retikulum, DNS, Ribosomen, Golgi-Vesikel, Kernpore, Kernkörperchen und Nukleolus Im Gegensatz zu Pflanzenzellen fehlen: Chloroplasten und Vakuole
Thrombozyt
eine Blutzelle, die mit dem Gerinnungsprozess assoziiert ist
Thymin
Thymin ist eine der vier DNA- und RNA-Basen. Sie ist, ebenso wie Cytosin, eine Pyrimidinbase. Die korrespondierende Purinbase ist Adenin. Das Basenpaar wird über zwei Wasserstoffbrücken verknüpft.
Telophase
Phase bei Zellteilungen, bei der sich neue Kernhüllen und Tochterzellen bilden.
tetrapolid
vierfach; bei Zellen: Eine Zelle enthält vier Chromosomensätze statt der üblichen zwei Sätze der diploiden Zelle.
Tetraden
als Tetraden bezeichnet man die vier Chromatiden zweier gepaarter Chromosomen.
Telencephalon
Endhirn von griech. telos = Ende, Ziel, egkephalos = Gehirn. Es beinhaltet das Seh- und Hörzentrum, die Bewusstseinsfelder und die Körperfühlfelder.
Stigmen
seitliche Öffnungen der Tracheenatmung
Subcutis
Unterhaut mit Fettgewebe; darüber liegen Leder- und Oberhaut.
Spongiosa
Der eigentliche Lamellenknochen; schwammartiges Geflecht aus feinsten Knochenlamellen, das den Belastungslinien des Knochens folgt. Diese wird von der kompakten Korticalis umhüllt, die außen liegt.
Spindelapparat
System von Fasern, die von einem Pol der Zelle zum andern verlaufen und bei der Verteilung der Chromosomen während der Mitose eine Rolle spielen.
Sichelzellanämie
Menschliche, genetisch bedingte Blutkrankheit (rezessiv). Name stammt von den sichelartigen Verformungen der Erythrocyten der Patienten. Ursache ist eine Mutation an der 6. Stelle der Beta-Kette des Hämoglobins (Austausch von Glutaminsäure gegen Valin). Vielfältige Auswirkungen. Heterozygote zeigen eine erhöhte Malaria-Resistenz.
Schizocoelie
Bildung des Coeloms durch Aufspaltung des Hypomers
Rückenmark
Der Teil des Zentralnervensystems, der vom Hirnstamm zur Cauda equina reicht (der Ansammlung von Spinalnerven, die vom unteren Teil des Rückenmarks abgehen; ihr Erscheinungsbild ähnelt dem eines Pferdeschweifs). Es fungiert als sensorische und motorische Leitung zwischen Körper und Gehirn und wird durch die Wirbel geschützt.
Rumen
die größte Kammer des Wiederkäuermagens
Ribosomen
Die Ribosomen sind die Eiweiß-Fabriken der Zellen, die anhand von verschlüsselten Bauanleitungen Eiweiße herstellen.
RNA
eine Nukleinsäure, die bis auf zwei kleine Unterschieden eine Kopie der DNA ist. Sie ist im Gegensatz zur DNA einzelsträngig und nicht doppelsträngig.
Rhesusfaktor
ein Antigen der roten Blutzellen, wird dominant-rezessesiv vererbt. Blutgruppen werden entweder als rhesus-positiv oder -negativ bezeichnet.
Rhodopsin
Sehfarbstoff in der Netzhaut der Augen von Wirbeltieren und in den Photorezeptoren von Evertebraten. Es handelt sich dabei um eine Verbindung des Proteins Opsin und Retinal.
rezessiv
(lat. recedere = zurückweichen) eine rezessive Erbanlage wird von einer dominanten überdeckt. D.h. die rezessive Erbanlage tritt nur bei Homozygotie in Erscheinung.
Restriktionsenzyme
Restriktionsendonukleasen. Endonuclease, die DNA sequenzspezifisch schneiden. Werden aus Bakterien isoliert, diese brauchen die Enzyme, um sich vor Fremd-DNA zu schützen. Ihre eigene DNA ist an den entsprechenden Stellen modifiziert (Methylierung) und wirddaher von den eigenen Restriktionsenzymen nicht geschnitten. Heute sind über 250 Restriktions...
Retinoide
Abkömmlinge der Vitamin-A-Säure. Insbesondere Schwangere dürfen keine Retinoide erhalten, da Missbildungen bei neugeborenen Kindern die Folge sein können.
Quartärstruktur
Abwandlung von Tertiärstrukturen im makromolekularen Bereich durch Vergesellschaftung mehrerer Moleküle zu einem gemeinsamen Strang (=> Linearprotein) oder zu einer Netzkugel (=> globuläres Protein)
Quadrantenhemianopsie
völliger oder teilweiser beidseitiger Gesichtsfeldausfall in Quadranten-Form infolge zentraler Sehbahn- oder Sehrindenschädigung (z.B. unten links bei Läsion über dem rechten Sulcus calcarinus).
Psoriasis
= Schuppenflechte, Autoimmunerkrankung bei der es durch beschleunigte Zellteilung der Haut zu Entzündung und Blutungen kommt.
Quenching
in der Immunologie ein fluoreszenzspektrometrisches Verfahren zur Untersuchung der primären Interaktion von Antigenen u. Antikörpern
Protocyte
kernlosen Zellen der Archaebakterien, Bakterien und Blaualgen.
Prosencephalon
Vorderhirn von griech. proso- = vorn, egkephalos = Gehirn. steuert die kognitiven, sensorischen und motorischen Funktionen und reguliert die Temperatur, die reproduktiven Funktionen, die Nahrungsaufnahme, das Schlafen und das Zeigen von Emotionen.
Prokaryonten
Lebewesen können in zwei große Domänen eingeteilt werden: Eukaryonten und Prokaryonten. Prokaryontisch sind alle Zellen, die im Unterschied zu den Eukaryonten keinen Zellkern besitzen. Unterschieden werden Bakterien und ihnen gegenüber die Archäa. Die Unterschiede zwischen beiden ähnlich aussehenden Gruppen sind so groß, dass manche Systematiker a...
Präzipitation
Vorgang bei dem durch die Agglutination sog. Immunkomplexe, entstehen, die so groß werden können, daß sie z.B. im Blutplasma nicht mehr löslich sind und ausfallen.
Proteine
Dreidimensionale Biopolymere, die aus zwanzig verschiedenen, als Aminosäuren bezeichneten Monomeren aufgebaut sind.
Prophase
Die Prophase schließt sich direkt an die Interphase an. Zu Beginn der Prophase liegen die Chromosomen noch als fädiges Knäuel vor. Im weiteren Verlauf verändern sich die Chromatinfäden durch Aufschraubung und Faltung, d.h. sie verdichten und verkürzen sich.
Polymerase-Kettenreaktion
Die Polymerase-Kettenreaktion (Polymerase Chain Reaction, PCR) ist eine Methode, um Desoxyribonukleinsäure (DNA) zu vervielfältigen, ohne dafür lebende Organismen, wie z.B. Colibakterien oder Hefe zu verwenden.
Polyploidie
Polyploidie herrscht in einer Zelle, wenn das haploide Genom, die Gesamtheit aller Gene, in mehrfach identischer Ausführung vorliegt.
Pons
Ein Teil des Metencephalons und des Hirnstamms und zwischen dem Mesencephalon und der Medulla gelegen. Die Pons leitet Impulse zur Steuerung von Bewegungsabläufen vom Cortex weiter und ist außerdem an der Steuerung des Schlaf- und Wachrhythmus beteiligt.
Polygenie
Beteiligung mehrerer Gene an der Ausbildung einer Eigenschaft; Normalfall der Phänogenese. Bei isophäner Polygenie volle Ausbildung des Phäns, auch durch jedes der beteiligten Gene allein; bei additiver oder kumulativer Polygenie quantitative Auswirkung; bei komplementärer Polygenie Ausbildung nur durch Kombination verschiedener, einzeln unentbehr...
Polyphänie
Unter Polyphänie oder Pleiotropie versteht man die Tatsache, daß ein Gen für viele Phänotypen (Merkmale) zuständig ist.
Plastiden
Plastiden sind typische Organellen der Pflanzenzellen. Zu ihnen gehören zum einen die Chloroplasten. Daneben werden aber auch noch andere Organellen gezählt, zum Beispiel die farbigen Chromoplasten und die farblosen Leukoplasten, sowie Übergangsstadien.
Plasmaproteine
Im Blutplasma enthaltene Bluteiweiße.
pluripotent
Pluripotente Zellen sind auf keinen bestimmten Gewebetyp festgelegt. Sie besitzen die Anlage sich zu verschiedenen Zelltypen weiter zu entwickeln.
Plastron
ventraler Teil eines Schildkrötenpanzers
Phänotypen
Sichtbare oder auf andere Weise meßbare, physikalische oder biochemische Merkmale eines Organismus, die aus der Wechselwirkung von Genotyp und Umwelt resultieren.
Phyllosphäre
Mikroumwelt auf einem Blatt oder in seiner unmittelbaren Umgebung.
Phagozyten
Ein Phagozyt ist eine sog. 'Fresszelle', die belebte oder unbelebte Gewebs- oder andere Teile aufnehmen und verdauen kann.
Phenylketonurie
eine Stoffwechselkrankheit, bei der der Stoff Phenylalanin nicht mehr abgebaut werden kann, und sich dadurch im Körper ansammelt. Dies führt zu geistiger Behinderung. Durch eine frühzeitige Diagnose kann die Erkrankung mit Hilfe einer phenylalaninarmen Ernährung verhindert werden.
Photosynthese
Photosynthese ist die Umwandlung von Lichtenergie in chemische Energie durch Pflanzen mittels Chlorophyll (Chloroplasten). Es wird Kohlendioxid unter dem Einfluss von Licht und Wasser in Zucker umgewandelt.
Phagozytose
Phagocytose; Phagozytose ist der Prozeß, durch den Pathogene von den Phagozyten des Immunsystems des Wirts verschlungen und zerstört werden.
Periost
bindegewebige äußere Knochenhaut
Perforin
Protein, das cytotoxische T-Zellen ausschütten, das Löcher in die Zellmembran von Zielzellen bildet, sodaß diese am osmotischen Schock sterben.
Penetranz
Anteil der Individuen mit einer dominanten Mutation, welche Symptome erkennen lassen.
perineural
um einen Nerv herum
Osteocranium
der aus Deckknochen u. den - verknöcherten - Ersatzknochen des Chondrokraniums hervorgehende knöcherne Schädel.
Paläoanthropologie
Die Erforschung der Ursprünge und der Evolution des Menschen. Sie konzentriert sich auf den kurzen Zeitabschnitt, während dem sich die Menschen und Schimpansen von ihren gemeinsamen Vorfahren abzweigten.
Osmose
Diffusion von Wasser durch eine semipermeable Membran.
Osteoklasten
knochenabbauende Zellen. Damit der Knochen den mechanischen Belastungen gewachsen ist, wird durch Osteoklasten alte Knochenmasse abgebaut und durch Osteoblasten neue Zellstrukturen aufgebaut. Störungen dieses ständig stattfindenden Skelettumbaus können zu Erkrankungen des Knochens führen, wie z. B. zur Osteoporose.