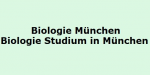Kopie von `Biologie München - Biologie Lexikon`
Die Wörterliste gibt es nicht mehr oder die Website ist nicht (mehr) online.
Nachstehend finden Sie eine Kopie der Informationen. Eventuell ist die Information nicht mehr aktuell.
Wir weisen Sie darauf hin, bei der Beurteilung der Ergebnisse kritisch zu sein.
Kategorie: Pflanzen und Tiere > Biologie
Datum & Land: 20/05/2009, De.
Wörter: 295
Osteoblasten
Zellen, die die primär unverkalkte Knochensubstanz bilden. Die Osteoblasten schliessen sich hierdurch selbst im Knochen ein, sie werden dann als Osteocyten bezeichnet.
Orchitis
syn. Didymitis, Hodenentzündung; Entzündung des männlichen Hodens, die auch auf Nebenhoden und Samenstränge übergreifen kann, oft einhergehend mit Infektionskrankheiten wie Mumps oder Tuberkulose. Spätfolge kann unter anderem die Sterilität des Patienten sein.
Opsin
Eiweißkomponente des Sehpigments der Wirbeltiere. Das Opsin ist der Bestandteil der Sehpigments, der entscheidet, in welchem Bereich des Lichtspektrums der Sehfarbstoff besonders gut absorbiert.
Organellen
Verschiedene Körperchen mit spezialisierter Funktion, die im Cytosol der Eukaryotenzelle verteilt sind.
Ontogenese
Individualentwicklung eines Organismus.
Oogenese
Entwicklung der Eizelle
Oligomer
kurzes Polymer; Protein, das aus mehreren Polypeptidketten besteht.
Nucleoplasma
die gesamte, von der Kernmembran umschlossene Substanz einschließlich Chromahn, Kernfasern usw.
Nukleolus
große, nichtmembranbegrenzte Struktur innerhalb des Zellkerns. In dieser werden die rRNA-Moleküle synthetisiert und prozessiert, sowie die Ribosomenuntereinheiten aus rRNA und ribosomalen Proteinen zusammengebaut.
Nukleotid
Grundbaustein der Nukleinsäuren aus Nucleobase, Zucker (Desoxyribose- bzw. Ribose und Phosphat.
Nukleus
Zellkern einer eukaryotischen Zelle, der das genetische Material enthält und von einer Membran umschlossen wird Eine Ansammlung von Nervenzellkörpern innerhalb des Zentralnervensystems.
Nidation
Einnistung (Implantation) des berfruchteten Eis (meist im späteren Morulastadium oder als Blastozyste) in die hormonal durch Progesteron vorbereitete Gebärmutterschleimhaut (in prägravider - Sekretionsphase), die sich bald mit dem Trophoblasten verbindet, oder in die Schleimhaut der Tube (Eileiterschwangerschaft).
Neurocranium
der Teil des Schädels, der aus dem Chondrocranium entsteht
Neurulation
Entwicklungsstadium während der Embryogenese nach Abschluß der Gastrulation
Myxodermie
primäre Anreicherung schleimartiger Substanzen in der (Leder-)Haut, z.B. diffus bei Myxödem. S.a. Muzinose.
Mutation
Ungerichtete Veränderung im Genom. Die Änderung findet an einer mehr oder weniger zufälligen Stelle statt und betrifft irgendein Gen. Sie kann vollkommen ohne Auswirkungen bleiben, weil der Bereich, in dem sich durch die Mutation eine Veränderung in der DNA-Sequenz ergeben hat, ohnehin nicht abgelesen wird (sogenanntes Intron).
Monozyt
größter Typ der weißen Blutkörperchen (Agranulozyt); Sie können das Blut verlassen und im Gewebe als Makrophagen z. B. infektöse Bakterien und Pilze phagozytieren.
Monokultur
Große, von einer einzigen Pflanzenart (oder bei Nutzpflanzen einer einzigen Varietät) bedeckte Fläche; experimentell der Anbau einer einzigen Pflanzenart.
Morula
Bei vielzelligen Tieren und beim Menschen der durch Furchung der befruchteten Eizelle entstandene Zellkomplex etwa 3-4 Tage nach der Befruchtung - später wird die Morula zur Blastozyste.
Morulastadium
Das Morulastadium is ein Stadium in der pränatalen Entwicklung: geschlossener Zellverband mit mindestens 12- 16 Zellen, ca. am 3. und 4. Tag
Monosomie
Bei einer Monosomie fehlt eines der beiden homologen Chromosomen in einem sonst diploiden Chromosomensatz.
monohybrid
Erbgang, bei dem nur die Vererbung eines einzelnen Merkmals betrachtet wird.
Mikrotubuli
Röhrenförmige Zellstrukturen, die wie ein Gerüst auf- und abgebaut werden können und so u.a. die Form der Zelle beeinflussen. Bei der Zellteilung sorgen sie für die richtige Verteilung der verdoppelten Chromosomen in die Tochterzellen.
Mikrobodies
Zellorganell, das Wasserstoffperoxid zersetzt.
Mitochondrien
Die Organellen in Eurozytenzellen, in denen die Zellatmung abläuft.
Mitose
Teilung von Zelle u. Zellkern im Dienste der Wachstums- u. Zellerneuerungsprozesse. Sie verläuft in verschiedenen Phasen: Prophase, Metaphase, Anaphase und Telophase.
Mendel, Johann Gregor
(1822-1884) Österreichischer Biologe. Nach jahrelangen systematischen Kreuzungsversuche mit Erbsen entdeckt Mendel 1865 die nach ihm benannten Mendel'schen Gesetze.
Megaphyten
Pflanzen mit normalerweise unverzweigten Sprossen oder Stämmen und einer Krone aus sehr großen Blättern; auch die Blütenstände sind häufig sehr groß.
Melatonin
Hormon der Epiphyse; steigert u.a. die Antikörperproduktion
Mesophyll
Das innere Gewebe eines Blattes (ohne Leitgefäße). Bei grünen Pflanzen befinden sich in diesen Zellen die meisten Chloroplasten und hier findet die Photosynthese statt.
Metencephalon
Der Bereich des Gehirns, der aus der Pons, der Medulla und dem Kleinhirn besteht. Das Metencephalon koordiniert motorische Aktivitäten, Körperhaltung, Gleichgewicht und Schlafmuster und reguliert unbewusste, aber wichtige Funktionen, wie beispielsweise die Atmung und den Blutkreislauf.
Mesencephalon
Zwischen dem Metencephalon und dem Prosencephalon gelegen, bildet das Mesencephalon einen Teil des Hirnstamms und verbindet den Hirnstamm mit dem Prosencephalon. Das Mesencephalon ist verantwortlich für die Steuerung sensorischer Prozesse.
Medulla oblongata
Dieser Teil des Gehirns bildet einen Teil des Metencephalons und des Hirnstamms und verbindet das Rückenmark mit der Pons. Die Medulla oblongata ist an der Steuerung unbewusster grundlegender Funktionen wie beispielsweise der Atmung, des Blutkreislaufs und des Muskeltonus beteiligt.
Meiose
Halbierung des Chromosomenbestandes. Um die Verdopplung des Chromosomensatzen bei der Befruchtung zu kompensieren wird die Chromosomenanzahl in den Gameten halbiert.
Mesoderm
Mesoderm ist das mittlere bzw. 3. Keimblatt neben dem Entoderm und dem Ektoderm. Die Mesoderm-Zellen entstehen beim Menschen in der dritten Entwicklungswoche durch Einwanderung zwischen Epiblast und Hypoblast.
Metaphase
Zweite Phase der Mitose. Hier bilden sich Kernhülle und Nucleolus zurück. Es entsteht ein Spindelapparat, der von zwei sich gegenüberstehenden Zentrosomen ausgeht. Die Chromosomen sind in diesem Stadium maximal verkürzt und können nach Form und Größe unterschieden werden.
Makrophage
Monozyt außerhalb des Bluts
Lysosomen
ysosomen sind winzige, von einer Membran umschlossene Zellorganellen in Eukaryonten. Die Bläschen werden vom Golgi-Apparat gebildet und enthalten hydrolytische Enzyme und Phosphatasen. Ihre Hauptfunktion besteht darin, aufgenommene Fremdstoffe mittels der in ihnen enthaltenen Enzyme zu verdauen.
Lymphe
Flüssigkeit im lymphatischen System und in den Gewebszwischenräumen
Ligasen
Enzyme, die zwei Nukleinsäureenden miteinander verknüpfen. Insbesondere die Bildung einer neuen Phosphodieseterbrücke aus einem 3'-OH-Ende und einem 5'-Phosphatende zweier Nukleinsäuremoleküle unter ATP-Verbrauch. Häufig benutzt wird die T4-DNA-Ligase aus dem gleichnamigen Bakteriophagen.
Lipide
von griech.: lipos = Fett, Öl Sammelbezeichnung für langgestreckt aufgebaute Zell-Inhaltsstoffe mit sog. Kopf- und Schwanzteil und wasserabweisenden Eigenschaften. Lipide können sich aufgrund der für sie typischen Strukturen und Eigenschaften spontan so zusammenlagern, dass die Schwanz-Enden (wasserabweisend) zueinander zeigen und die polaren Kopf...
Leberzirrhose
Zerstörung und Vernarbung von Leberzellgewebe. Die Funktionstüchtigkeit der Leber wird mit fortschreitender Zirrhose eingeschränkt. Die Leberzirrhose entwickelt sich aus einer Leberentzündung verursacht durch Alkoholmissbrauch, Virusinfektionen oder andere Leberschädigungen.
Kretinismus
Kinderkrankheit während der Schwangerschaft. Die Schilddrüse des Kindes produziert zu wenig Thyroxin, wodurch der Stoffwechsel verlangsamt wird, und es zu Entwicklungsverzögerungen des zentralen Nervensystems kommt.
Lagena
eine Erweiterung des Sacculus des Innenohrs
Leukozyten
weiße Blutkörperchen, Für die Immunabwehr zuständig
Kompartment
allgemein: abgegliederter Raum; in der Entwicklungsbiologie oft der Raum, den die Abkömmlinge einer Gründerzelle (Klon) einnehmen und nie verlassen
Krypsis
Umgebungstracht; Erscheinungsform eines Organismus, die seine Entdeckung erschwert, zum Beispiel Tarnung vor Räubern.
Kolloid
Ein Kolloid oder kolloidale Lösung ist eine Lösung in der ein Stoff in einem Lösungsmittel sehr fein verteilt ist. Das Kolloid als auch das Lösungsmittel können ein Feststoff, eine Flüssigkeit oder ein Gas sein. Das Wort leitet sich vom griechischen kolla (= Leim) und eidos (= Form, Aussehen) ab.
Kodominanz
zwei Allele exprimieren ihren Phänotyp unabhängig von einander.
Kodon
Abfolge von drei Basen, die die Information für eine Aminosäure oder ein Stopsignal enthält. Lineares Basentriplett einer mRNA, die in der Translation für eine Aminosäure codiert.
Kapillare
ein mikroskopisch kleines Blutgefäß, durch dessen Wand Diffusion stattfindet
Karyotyp
Chromosomensatz eines Individuums
Kleinhirn
Der hintere Teil des Hirns der Zuständig für Steuerung der Gleichgewichtsregulation, Bewegungskoordination und Motorik ist
jugularis
auf die Kehle oder den Hals bezogen
juvenil
jugendlich, noch nicht geschlechtsreif
Kardiomyopathie
Oberbegriff für verschiedenartige Erkrankungen des Herzens, die mit unterschiedlichen Veränderungen des Herzmuskels und selten auch der inneren Herzschicht einhergehen.
Karyogramm
Mikroskopisches Bild aller im Zellkern enthaltenen Chromosomen, meistens nach Größen sortiert dargestellt.
induzieren
hervorrufen, bewirken, auslösen
Intermediär
dazwischenliegend
ischämisch
mangelhaft oder nicht durchblutet
intraartikulär
im Inneren eines Gelenkes liegend.
Interleukin
Signalstoff der Lymphozyten und Makrophagen; = Cytokinin zur Aktivierung anderer Immunzellen
Injektionsphase
zweite Phase, wenn ein Virus eine Zelle befällt; das Virus injiziert seine Nukleinsäure in die Zelle
Intron
Introns (sg. Intron) sind die Abschnitte der DNA innerhalb eines Gens, die nicht für aktuell produzierte Proteine oder Proteinabschnitte kodieren, da sie aus der prä-mRNA herausgespleißt werden, bevor diese zur Translation aus dem Zellkern herausgeschleust wird. Die in der reifen mRNA verbleibenden Teile des Gens nennt man Exons. Introns und die A...
Insult
Schlaganfall: Plötzlich autretende, blutgefäßbedingte Störung der Hirnfunktionen, die meist auf einen Hirninfarkt, sonst auf eine Hirnblutung durch Gefäßriss zurückgeht.
Inadult
nicht ausgewachsen, Jugendstadium
Interphase
Die Interphase ist ist die Phase zwischen zwei Zellteilungen einer eukaryontischen Zelle. Die Zelle wächst die stark, es werden die Erbinformationen verdoppelt. Danch folgt die Mitosephase
Hämoglobin
Das Protein Hämoglobin besteht aus einer farbgebenden Gruppe, dem Häm, und einem Eiweisanteil, dem Globin. Es gibt dem Blut seine rote Farbe. Seine Funktion ist der Sauerstofftransport von den Atemorganen zu den sauerstoffverbrauchenden Geweben.
Ikterus
Gelbsucht
Immunkomplex
Zusammenlagerung von Antikörpern und Antigen (z. B. Krankheitserreger). Die Erreger werden dadurch inaktiviert. Die Immunkomplexe werden von Freßzellen aufgenommen und zerstört.
Hyoidbogen
der zweite Visceralbogen
Hyomandibulare
das dorsale und hauptsächliche Segment des Hyoidbogens
Hybride
nicht fortpflanzungsfähige Kreuzung zweier Arten.
Hypoblast
innere Zellschicht des Embryoblast, die der Dottermasse aufliegt und vom Epiblast überlagert ist.
Hydroxylierung
durch eine chemische Reaktion wird eine OH-Gruppe in ein bestehendes Molekül eingebunden.
homologe Chromosomen
die beiden, sich jeweils in Form und Größe entsprechenden Chromosomen von Mutter und Vater.
Homozygot
Gleichheit der vom Vater und der Mutter erhaltenen Erbanlagen für ein bestimmtes Codon.
homolog
(altgriechisch für 'gleichlautend', 'entsprechend') Homologe Strukturen sind herkunfts-, aber nicht notwendigerweise funktionsgleich.
Hirnstamm
Der stammähnliche Teil des Gehirns, der das Rückenmarkund das Prosencephalon verbindet.Es besteht aus der Pons, der Medulla oblongata und dem Mesencephalon. Der Hirnstamm fungiert als wichtige Verbindungsstation: Jeder Nervenimpuls zwischen Gehirn und Rückenmark muss den Hirnstamm passieren, um eine normale Funktion des Körpers zu gewährleisten.
Heterochromatin
verdichtete Bereiche auf den Chromosomen, in denen keine oder nur in geringem Umfang Transkription stattfindet
Hippocampus
ein Derivat des Archicortex in Form eines gebogenen Bandes, das sich an den lateralen Ventrikel anschließt
Hemidesmosomen
Hemidesmosomen sehen elektronenmikroskopisch wie halbe Desmosomen aus und vermitteln den Kontakt zur Basallamina. Sie werden also insbesondere von Epithelzellen und Endothelzellen expremiert. Die Adhäsionsmoleküle sind hier nicht Cadherine sondern die Integrine, die mit Komponenten des Extrazelluläraumes bzw. der Basalmembran interagieren.
heterozygot
mischerbig, zwei sich unterscheidende Gene (beim diploid Satz Chromosomen) für ein Merkmal, im Gegensatz zu homozygot.
hemizygot
als hemizygot wird bei einem diploiden Organismus der Zustand bezeichnet, wenn nur eine Kopie eines Gens vorhanden ist.
Heterogametie
die Bildung zweier verschiedener geschlechtsbestimmender Gameten bei einem Geschlecht (z.B. beim Menschen - normal im 1:1-Verhältnis - von Spermien mit X- oder Y-Chromosom).
Granulationsgewebe
zell- und gefäßreiches Gewebe, das im Rahmen einer Entzündung gebildet wird, oberflächliche Wunden vor
Habitat
Ort, an dem ein Mikroorganismus, eine Pflanze oder ein Tier lebt.
haploid
Eine haploide Zelle besitzt im Gegensatz zur diploiden von jedem Chromosom nur ein Exemplar anstatt zwei. Ein normalerweise doppelter Chromosomensatz wird in der Meiose bei der Bildung der Gameten (Geschlechtszellen) auf einen einfachen Chromosomensatz reduziert. Gegensatz: diploid
gonosomal
die Geschlechtschromosomen betreffend
Gonosomen
Geschlechtschromosomen (= Heterosomen), beim Mensch X und Y. Jeweils eines dieser Chromosomen wurde vom Vater oder von der Mutter vererbt.
Globuline
Globuline sind viele verschiedene Proteine, die verschiedene Aufgaben haben. So gibt es zum Beispiel Alphaglobuline und Betaglobuline. Diese Antikörper kommen im Blutserum am häufigsten vor.
Glykosylierung
Anheftung von Zuckerresten unter Abspaltung von Wasser an eine organische Verbindung, z.B. an ein Protein oder ein Lipid.
Glomerulum
Knäuel von Kapillaren innerhalb der Nierenkapsel; verschiedene Aggregate von Nervenfasern
Glutaminsäure
proteinogene Aminosäure besser als Glutamat bezeichnet, diese Aminodicarbonsäure hat ein C-5 Gerüst, dessen zweite Carboxy-Gruppe deprotoniert (als Anion) vorliegt. Diese Aminosäure hat auch Neurotransmitter Eigenschaften.
Genotyp
Die Gesamhtheit aller Erbanlagen eines Organismus.
Genom
Die gesamte Erbsubstanz eines Organismus. Jede Zelle eines Organismus verfügt in Ihrem Zellkern über die komplette Erbinformation.
Genfluss
ein genetischer Austausch aufgrund von Wanderungen fruchtbarer Individuen oder Gameten zwischen Populationen
Gameten
Keimzellen, d. h. Eizellen oder Spermien
Furchung
Als Furchung wird die durch Teilungen der Zygote in Blastomeren durch Abschnürrung bis zum Morulastadium bezeichnet.
Gastrula
erstes embryonales Entwicklungsstadium