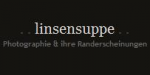Kopie von `LINSENsuppe - Photographie & ihre Randerscheinungen`
Die Wörterliste gibt es nicht mehr oder die Website ist nicht (mehr) online.
Nachstehend finden Sie eine Kopie der Informationen. Eventuell ist die Information nicht mehr aktuell.
Wir weisen Sie darauf hin, bei der Beurteilung der Ergebnisse kritisch zu sein.
Kategorie: Sport, Gesundheit und Freizeit > Photographie
Datum & Land: 25/04/2010, De.
Wörter: 83
Zentralverschluss
Oft in Mittelformat- & Kompaktkameras zu finden. Bei Auslösung öffnen sich die im Objektiv befindlichen Lamellen komplett; die einfallende Lichtmenge wird dann lediglich von der vor dem Verschluss gelegenen Blende reguliert. Der Verschluss arbeitet geräuschfrei und gibt (unabhängig von der gewählten Belichtungszeit) den gesamten Optikdurchmesser frei, sodass die gesamte Bild- bzw. Sensorfläche belichtet werden kann. Das hat auch eine sehr gute Blitzsynchronisation zur Folge; Limitierungen wie beim Schlitzverschluss bezüglich der Verschlusszeiten gibt es nicht. Nachteil: Einerseits sind die Lamellen eher träge (extrem kurze Verschlusszeiten sind damit nicht möglich), andererseits ist der Verschluss fest im Objektiv eingebaut. Zwar gibt es auch Kameras mit Wechselobjektiven, aber diese müssen jeweils mit einem eigenen Verschluss versehen sein.
Wechselobjektiv
Nicht fest in die Kamera integriertes, sondern austauschbares Objektiv.
Weißabgleich
Für bestimmte Lichttemperaturen kann eine spezifische Abstimmung erfolgen. [Vgl. Farbtemperatur.]
Weitwinkel
Objektive mit einer Brennweite, die kürzer als die eines Normalobjektivs ist. Bietet einen größeren Blickwinkel (ein breiterer Bereich vor der Kamera rückt ins Bild). Häufiger Fehler: Wenn der Vordergrund bei Landschaftsaufnahmen nichts Interessantes zu bieten hat, wird oft der Blick nicht in die Bildmitte gelenkt. Andererseits kann näher ans Motiv herangegangen & zugleich der Hintergrund scharf abgebildet werden (große Schärfentiefe). Bei Portraits: Gefahr der Verzerrung von Gesichtern (vgl. Verzeichnung).
VR
Vibration reduction (Bildstabilisierung).
Vignettierung
(Abschattung) Abschattungen können mehrer Ursachen haben und sind zumeist störend, können aber auch absichtlich durch entsprechende Filter hervorgerufen werden (man denke an Konfirmations- oder Hochzeitsbilder). Unbeabsichtigt entstehen sie, wenn ein Gegenstand Bereiche des Bildes verdeckt; das Motiv kann dann nicht komplett aufgenommen werden. Zudem kann es passieren, dass Sucherbild und Aufnahme voneinander abweichen (viele Kameras zeigen nur etwa 95%); das Bild kann dann Bereiche enthalten, die nicht im Sucher zu sehen waren. Außerdem treten sie oft an den Rändern und v.a. den Ecken eines Bildes auf; dies geschieht bei der Verwendung nicht geeigneter Objektivvorsätze (wie Gegenlichtblenden).
Verschlusszeit
Auch Belichtungszeit genannt. Besagt, wie lange der Film/Sensor belichtet wird. Zeiten unter 1 Sek. werden im Sucher i.d.R. als ganze Zahl angezeigt, Zeiten über 1 Sek. mit '. Bsp. 1/750 Sek, wird als 750 angezeigt (manchmal auch als 0 ' 7), 4 Sek. als 4 '. Kurze Verschlusszeiten frieren Bewegungen ein, lange Verschlusszeiten sind eher für statische Motive geeignet (außer man wünscht dynamische Bewegungsunschärfe). Mehr über das Zusammenspiel von Blende und Verschluss hier.
Verschlussvorhang
Auch Schlitzverschluss genannt. Direkt vor der Film- (Sensor-) Ebene (also der Bildebene) horizontal oder vertikal verlaufende Vorhänge, die elektronisch gesteuert werden. Eine Hälfte öffnet sich und legt die Filmebene frei; derweil schließt sich die andere Hälfte mit gleicher Geschwindigkeit und verdeckt die Filmebene wieder; der daraus resultierende Lichtschlitz gab dem Verschluss seinen Namen. Unterschiedliche Belichtungszeiten werden durch unterschiedlich große Lichtschlitzöffnungen realisiert; die Geschwindigkeit, mit der sich der Vorhang bewegt, ist gleichbleibend. Der Film wird gleichmäßig in allen Bereichen belichtet. Gerade bei der Blitzsynchronisation ist oft vom '1. Vorhang' bzw. '2. Vorhang' die Rede; damit sind die beiden Hälften des Schlitzverschlusses gemeint. Durch die Lokalisation direkt vor der Filmebene in der Kamera ist der unbelichtete Film optimal vorversehentlichem Lichteinfall geschützt; daher ist ein Wechsel der Objektive einfach. [Vgl. Zentralverschluss.] Die Blitzsynchronisation ist leider sehr begrenzt und für jede SLR-Kamera charakteristisch. Abhilfe schafft dann nur ein Blitz mit langer Brenndauer bzw. Blitzlampen.
Verzeichnung
Abbildungsfehler bei Objektiven. Tonnenförmige Verzerrung (hauptsächlich in Weitwinkel-Position) oder kissen-/trapezförmige Verzerrung (hauptsächlich in Tele-Position).
UV-Filter
Farbneutraler Filter. Reduziert die UV-Lichtmenge und verhindert Dunstschleiereffekte (Gefahr von Unschärfen) und Blaustich. [Vgl. Skylightfilter.]
Verschluss
Bei mechanischen Verschlüssen irisförmig (Zentralverschluss) oder lamellenartig (Verschlussvorhang). In Digitalkameras oft elektronische Verschlüsse: Aktivieren bzw. Deaktivieren des CCD simuliert einen Verschluss; nach Deaktivierung wird keine Information mehr aufgezeichnet, auch wenn noch Licht auf den Sensor fällt. (Deshalb brauchen diese Apparate keinen Sucher; die permanente Vorschau im Display (die auch dann anzeigt, wenn kein Bild aufgezeichnet wird) ersetzt diesen. Der Verschluss regelt die Dauer der Belichtung (sog. Verschlusszeit).
Unterbelichtung
Das Bild wird kürzer belichtet, als es für die Verhältnisse richtig wäre. Das Resultat sind zu dunkle Bilder.
TTL
(Through the Lens) Belichtungsmessung (und auch Scharfstellung) durch das Objektiv. Vorteil: Die Messung ist nicht nur verschiedenen Lichtverhältnissen angepasst, sondern bezieht auch verschiedene Brennweiten und Zubehör wie Filter ein. Projektion in das Sucherbild durch Spiegel/Prismen (vgl. Spiegelreflex).
S
Auf der Programmwahlscheibe bezeichnet das S die Belichtungsautomatik mit Verschlusszeitvorwahl. Abkürzung von Shutter (Verschluss).
S/W
Abkürzung für Schwarz-Weiß-Fotos. Siehe auch: Graustufen.
Stativ
Hält die Kamera bei längeren Verschlusszeiten (= Belichtungszeiten) ruhig. Nivellierkopf: Erlaubt gleitende Bewegungen um 360°, zugleich vertikale Bewegungen (90° nach vorn, 45° nach hinten). Kugelkopf: 2 Schrauben zum Fixieren. Ähnliche Bewegungsmöglichkeiten, dabei aber handlicher. Dreibein- und Einbeinstative (letztere sind platzsparend, aber weniger verwacklungssicher).
Spiegelreflexkamera
Andere Bezeichnungen: SLR (Single-Lens Reflex), ESR (Einäugige Spiegelreflex). Prinzip & Funktion: t.b.c.
Slow-Sync
Blitz-Langzeitsynchronisation.
Skylightfilter
Sperrt wie der UV-Filter ultraviolette Strahlung. Dämpfung von Blau in Fernaufnahmen für eine wärmere Farbwiedergabe sowie Reduktion des atmosphärischen Schleiers (Dunst). Leicht rötlich gefärbt (und nicht, wie der UV-Filter, farbneutral).
Sepia
Bildeinfärbung in gelb-braun. Effekt: Das Bild wirkt alt.
Schlitzverschluss
Siehe Verschlussvorhang.
Selbstauslöser
Verzögert die Öffnung des Verschlusses. Dadurch kann bei sehr langen Belichtungszeiten ohne Vibrationen ausgelöst werden. Und na klar man kann sich selbst fotografieren.
Schärfentiefe
Entfernungsbereich, der bei der gewählten Blendenöffnung scharf abgebildet wird. Abhängig von der Blende, der Brennweite des Objektivs und dem Fokussierpunkt. Mehr zum Thema hier.
Rauschen
Bildrauschen, Farbrauschen. Grobkörniger Effekt bei Filmen mit hohem ISO-Wert, der v.a. bei Aufnahmen in der Nacht mit langen Verschlusszeiten zu Farbveränderungen führt (z.B. zufällig auftretende, sichtbare Punkte auf einer an sich unifarbenen Fläche, v.a. in dunklen Bereichen).
P
Auf der Programmwählscheibe die Bezeichnung für vollautomatische Programme, bei denen die Kamera sowohl die Blende als auch die Verschlusszeit wählt.
Polarisations-Filter
(PL-L) Kurz: Polfilter. Lichtwellen werden polarisiert, also nur bestimmt ausgerichtete Lichtwellen werden durchgelassen. Verringert oder beseitigt (abhängig vom Austrittswinkel) Reflexionen auf nicht metallischen Flächen (Wasser, Glas). Hebt zudem Farbsättigung und Kontrast an und dunkelt blauen Himmel nach (für knackigen Kontrast zu den Wolken). [Vgl. Filter, Licht]
Parallaxe
Die scheinbare Verlagerung eines Objektes aufgrund unterschiedlicher Beobachtungsstandorte. Phänomen bei Durchblick-Suchern, weil die Platzierung von Sucher und Objektiv versetzt ist. Tritt besonders deutlich bei Nahaufnahmen zu Tage. Oft haben Kameras Korrekturmarkierungen im Sucher, um den Parallaxen-Fehler zu vermeiden. Tritt bei SLR-Kameras nicht auf.
Optischer Zoom
Vergrößerung erfolgt durch ein Linsensystem und nicht elektronisch (digital). Qualitativ wesentlich hochwertiger.
Okular
Suchereinblick.
Objektiv
Linse oder Linsengruppe. Unterschiedliche Linsen (Sammel- und Zerstreuungslinsen) sind im Objektiv zu einem Linsensystem zusammengeschlossen und ermöglichen durch ihre Anordnung eine korrekte optische (also scharfe und helle) Abbildung des Motivs auf der Bildebene. Weitwinkel-, Normal-, Makro- und Teleobjektiven mit festen Brennweiten sowie Zoomobjektiven mit variablen Brennweiten. Jede Brennweite hat einen bestimmten Bildwinkel.
Neutral-Graufilter
(ND, Neutral Density) Drosselt die einfallende Lichtmenge um 2 Blendenstufen, reduziert also die Helligkeit. Einsatz: Für selektive Schärfe ist eine größere Blendenöffnung erwünscht; ein hochempfindlicher Film bringt die Kamera hinsichtlich schnellster Verschlusszeit/kleinster Blende bei gutem Wetter an ihre Grenzen.
Nahgrenze
Kürzeste scharfzustellende Entfernung eines Objektivs. [Vgl. Aufnahmebereich.]
Nahlinse
Wird wie ein Filter vor das Objektiv der Kamera geschraubt und ist quasi wie eine Lupe. Im Gegensatz zum Makro-Konverter ändert sich lediglich der Abbildungsmaßstab, ohne die Nahgrenze zu verkürzen. Die Stärke der Vergrößerung wird in Dioptrien (dpt) angegeben.
M
Manueller Modus auf dem Programmwählrad. Manuelle Einstellung von Blende und Verschlusszeit.
MF
Manual Focus. Manuelle Scharfstellung. [Vgl. Fokus.]
Monochrom
Richtige Bezeichnung für s/w-Bilder, denn die bestehen aus Graustufen, nicht nur aus Schwarz und Weiß. Vgl. Graustufen.
Mattscheibe
Auch Sucherscheibe genannt. Quasi die Projektionsebene bei Spiegelreflexkameras für das durch Objektiv einfallende Licht. Enthält Hilfen für die Scharfstellung (Mikroprismenring, Schnittbildindikator).
LZ
Leitzahl eines Blitzes. Gibt Auskunft über Leistungsfähigkeit (und damit die Reichweite) des Blitzgerätes. Je höher, desto leistungsfähiger.W ie weit der Blitz reicht, lässt sich einfach errechnen, wenn die LZ bekannt ist: LZ = Blende x Entfernung (in m). [Vgl. Blitzleitzahl.]
Lichtstärke
Verhältnis des maximalen Öffnungsdurchmessers eines Objektivs (= kleinste Blendenzahl = größte Blendenöffnung) zur Brennweite. Weiterhin Maß für die Leuchtkraft von Lichtquellen (Einheit: Candela).
Licht
Sichtbares Licht ist eine Mischung aus mehreren Wellenlängen (polychromatisches = mehrfarbiges Licht). Mit z.B. einem Prisma kann es in seine monochromatischen (= einfarbigen) Bestandteile zerlegt werden (Spektralfarben). Die einzelnen Spektralfarben haben jeweils unterschiedliche Wellenlängen: Violett hat dabei die kürzeste (etwa 400 nm), dann folgen Blau, Grün, Gelb und Orange und schließlich Rot mit der längsten Wellenlänge (ca. 700 nm). Die Farbübergänge sind fließend und oft mit eigenem Namen versehen. [Vgl. Filter, Farbtemperatur.]
Linse
Optisch wirksames Bauelement mit zwei lichtbrechenden Flächen, von denen mindestens eine Fläche konvex (nach außen) oder konkav (nach innen ) gewölbt ist. Speziell geformter oder geschliffener Glas- bzw. Kunststoffkörper. Trifft ein Lichtstrahl auf die Grenzfläche zwischen Luft und Linse, wird immer ein Teil des Lichts reflektiert, der andere Teil dringt in die Linse ein, ändert dabei jedoch seine Ausbreitungsrichtung: Das Licht wird gebrochen. [Vgl. Objektiv.]
Lens
Englische Bezeichnung für Objektiv.
Lichtwert
(EV) Maß für die Helligkeit bei der Belichtungsmessung. Der Lichtwert 0 kennzeichnet die Lichtmenge bei Blende F/1 und bei 1 Sekunde Verschlusszeit. Der Lichtwert wird jeweils um den Faktor 1 erhöht, wenn die Blende um 1 vollen Blendenwert oder die Verschlusszeit um 1 Stufe zunehmen (bei Verringerung erniedrigt er sich entsprechend). Der Lichtwert wird auch für die ISO-Empfindlichkeit verwendet. Mehr Infos über das Zusammenspiel von Blende und Verschluss hier.
Konversionsfilter
Farbkorrekturfilter. Beeinflussen die Farbtemperatur des einfallenden Lichts. Beseitigen Farbstiche durch sehr 'warme' bzw. 'kalte' Beleuchtung und ermöglichen so die Verwendung von Tageslicht-Farbfilmen bei Kunstlicht sowie Kunstlichtfilmen bei Tageslicht. Rötlich (CCA): Dämpfung überschüssigen Blaus. Bläulich (CCB): Dämpfung überschüssigen Rots (Sonnenaufgang-).
Kelvin
Abkürzung: K. Maßeinheit für die Temperatur von Licht. Kelvin-Temperaturskala: beginnt beim absoluten Nullpunkt (ca. †“ 273° Celsius = 0 Kelvin). Umrechnung von Celsius in Kelvin-Werte: Addition von 273 zur Celsius-Gradzahl. [Vgl. Farbtemperatur.]
JPG, JPEG
Bildformat mit Kompression. Bei vielen digitalen Kameras Standardausgabeformat.
KB-Film
(Kleinbild-) Auch 35 mm-Format (nach der Breite des Filmstreifens, nicht nach dem Format des Bildes) oder 135 genannt. Hat ein Format von 24×36 mm [Seitenverhältnis 3:2], ist weltweit am weitesten verbreitet und seit 1913 in Gebrauch.
Histogramm
Grafische Darstellung der Helligkeitsverteilung in einem Bild.
ISO
(ISO-Empfindlichkeit) Messstandard der ISO (International Organization of Standardization) für die Filmempfindlichkeit. Je höher der ISO-Wert, desto höher die Empfindlichkeit. (Ein ISO 100-Film ist z.B. halb so empfindlich wie ein Film mit ISO 200. Ein ISO 400- Film hingegen ist 4 x so empfindlich. Wäre beispielseise die Einstellung Blende f/5.6 und Verschlusszeit 1/25 Sek. für ISO 100 richtig, so ändert sie sich (bei gleicher Blende) bei ISO 200 auf 1/50 Sek., bei ISO 400 auf 1/100 Sek.). Filme mit hohem ISO-Wert erlauben auch bei geringer Umgebungshelligkeit noch Aufnahmen ohne Blitz. Aber: Mit steigenden ISO-Werten werden die Filme immer grobkörniger (sog. Rauschen), weil die lichtempfindlichen Kristalle (Silberhalogenidkristalle; so schimpfen sich die lichtempfindlichen Kristalle korrekt) größer sind. Bei veränderten ISO-Einstellungen an einer Digitalkamera verhält sich diese ähnlich wie der analoge Film, obschon der Sensor keine Kristalle besitzt. [Vgl. CCD.]
Graustufen
Bei s/w-Aufnahmen werden verschiedene Farbwerte in unterschiedliche Graustufen umgesetzt. Siehe auch: Monochrom.
Gegenlichtblende
Verhindert den Einfall von Streulicht (fällt entweder als Sonnenstrahl direkt auf die Frontlinse oder wird von Oberflächen gespiegelt). Streulicht kann Reflexionen, Geisterbilder oder Schleier hervorrufen.
f/stop
Belichtungsstufe. 1 f/stop kleiner bedeutet: 1 volle Blende kleiner. Oft werden die Angaben über die verwendeten Blende bei einer Aufnahme auch in dieser Form geschrieben: f/Blende (z.B. f/5.6).
Fokus
Der Brennpunkt, also der Punkt auf der Bildebene, an dem sich alle parallel zur optischen Achse einer Sammellinse oder eines Objektivs einfallenden Lichtstrahlen treffen. Dort entsteht das scharfe Bild, daher ist hier der Film bzw. Sensor lokalisiert. Bei der Scharfstellung (Fokussierung) werden die Linsen des Objektivs so in Position gebracht, dass ein Bild scharf auf der Bildebene abgebildet werden kann.
Filter
Licht setzt sich aus vielen Wellenlängen zusammen; bei getrennter Wahrnehmung könnten wir die Spektralfarben (rot, orange, gelb, grün, blau, indigo, violett) sehen. Farbfilter beeinflussen die spektrale Zusammensetzung des auf den Film treffenden Lichts (Farbkorrekturfilter, Konversionsfilter). Bei s/w-Bildern kann die Tonwertwiedergabe gesteuert werden. Andere Filter reduzieren die UV-Menge (sog. UV-Filter) oder legen Effekte (z.B. Vignettierung ) über das Bild (sog. Effektfilter).
Filmempfindlichkeit
Siehe ISO.
Fisheye
Besondere Objektive mit einem Bildwinkel von 180°. Diagonal-Fisheye (rechteckiges, formatfüllendes Bild) und Zirkular-Fisheye (kreisrundes Bild).
Farbtemperatur
Die Spektralbreite von Weißlichtquellen [vgl. Licht] wird als Farbtemperatur durch eine Nummer angegeben. Maßeinheit für die Farbtemperatur: Kelvin (K). Je höher die Farbtemperatur, desto mehr Blau und weniger Rot †“ und natürlich umgekehrt: je niedriger die Farbtemperatur, desto mehr Rot und weniger Blau. Vor allem Fotos unter Fluoreszenzlicht oder gemischtem Licht (Tageslicht und Kunstlicht) können unnatürliche Farbverschiebungen zeigen. Durch einen Weißabgleich kann in solch schwierigen Lichtverhältnissen eine korrekte Farbcharakteristik erreicht werden.
Exposure
Aufnahme.
EV
(Exposure Value) Lichtwert. Eine Veränderung von +1 EV z.B. in Belichtungsreihen bedeutet: Die berechnete Blenden-/Verschlusszeit-Kombination für eine korrekte Belichtung wird um +1 Blende (auch als +1 Stopp bezeichnet) verändert. Für -1 EV gilt analoges in umgekehrter Richtung. (Man spricht auch von Belichtungskorrektur.) Aber Vorsicht! Eine Veränderung von nur ±1/3 EV ergibt nicht einfach nur ein helleres oder dunkleres Bild, sondern reduziert die Farbdichte um 10% (v.a. bei Diapositiven). Weniger als eine Veränderung von 1/3 EV (= 1/3 Blende = 1/3 Stopp) ist nicht mehr wahrnehmbar, daher bieten Kameras minimal die EV-Veränderung in Drittel-Stufen an. Auch einige ältere SLR wie z.B. die Canon A-1 von 1978 haben bereits eine Belichtungskorrektur-Skala, die in Drittelstufen einstellbar ist. Wenn eine Belichtungskorrektur nicht vorgesehen ist, kann man auch durch eine ISO-Korrektur ein vergleichbares Ergebnis erzielen.
DX-Kodierung
Ein Strichcode und Kontaktfelder auf der Filmpatrone von Kleinbild-(KB-)Filmen geben Auskunft über die Filmempfindlichkeit und einige andere Informationen. Auch am entwickelten Film ist eine Kodierung. Diese DX-Kodierung wird von vielen Kameras und bei der Entwicklung im Labor ausgelesen. Für Push und Pull muss eine Kamera mit DX-Code-Erkennung über eine Möglichkeit verfügen, die ISO-Empfindlichkeit manuell einzustellen.
CCD
(Charge-coupled Device) Bildwandler, auch Sensor genannt, der das durch das Objektiv einfallende Licht in elektrische Signale umsetzt. Verschiedene Hersteller verwenden unterschiedliche Sensorgrößen. Bedingt durch diese Größe ergibt sich bei digitalen Apparaten ein Umrechnungsfaktor, der z.B. aus einem Olympus-Objektiv mit 14mm Brennweite ein 28mm-Pendant im analogen 35mm-Bereich macht. Bei langen Brennweiten (Tele-Bereich) ist das durchaus von Vorteil, weil man mit einem Objektiv mit kürzerer Brennweite näher herankommt, als das im analogen Bereich der Fall wäre. Bei Weitwinkel-Objektiven aber kann das von Nachteil sein, wie das oben angeführte Beispiel zeigt: 14mm wären ein waschechtes Weitwinkel-Objektiv, aber bei umgerechneten 28mm ist der Bildwinkel, also der im Bild erfassbare Bereich, schon kleiner. Beim Sensor einer Digitalkamera sind auch verschiedene Filmempfindlichkeiten einstellbar. Vergleichbar mit den ISO-Werten eines analogen Films verhält sich auch ein CCD, der zwar im Gegensatz zu diesem keine Kristalle besitzt, aber immer ein Rauschen produziert. Bei normal starken Signalen fällt das kaum auf, bei schwachen Signalen aber ist der Signal-Rausch-Abstand (also der Abstand zwischen dem aufzunehmenden Signal und dem elektronischen Grundrauschen) sehr gering. Entsteht eine Aufnahme unter solchen Bedingungen, wird das Bild zu dunkel; eine Heraufsetzung der ISO-Zahl bringt da zwar Abhilfe, indem das schwache Signal verstärkt wird, aber unglücklicherweise wird das Grundrauschen mit verstärkt und zeigt sich dann bei hohen ISO-Zahlen sehr deutlich, besonders im Bereich von großen, einheitlich gefärbten Flächen. Vgl. Rauschen.
Brennpunkt
Siehe Fokus.
B
(Bulb) Auf der Verschlusszeitenskala steht das B für Bulb und erlaubt Aufnahmen, die länger belichtet werden sollen als die längste angegebene Verschlusszeit. Der Verschluss bleibt geöffnet, so lange der Auslöser gedrückt gehalten wird.
Brennweite eines Objektivs
Abstand zwischen der Mitte des Linsensystems und dem Brennpunkt (Film bzw. CCD). Die Normalbrennweite liefert einen etwa dem des menschlichen Auges entsprechenden Blickwinkel.
Blitzsynchronisation
Koordination des Blitzgerätes mit dem Verschluss. Sorgt dafür, dass die Zündung des Blitzes dann erfolgt, wenn der Verschluss geöffnet ist. Langzeitsynchronisation (Slow-sync): Dabei wird mit einer längeren Verschlusszeit geblitzt. Die Blitzdauer (Leuchtzeit) selbst ist wesentlich kürzer ist als die eingestellte Verschlusszeit, daher wird der Blitz entweder vor Ablauf der eingestellten Verschlusszeit (Langzeitsynchronisation auf den 1. Verschlussvorhang) oder danach (Langzeitsynchronisation auf den 2. Verschlussvorhang) ausgelöst. Diese Technik führt zu wesentlich stimmungsvolleren Blitzbilder, da die längere Verschlusszeit das Umgebungslicht einfängt, während das Licht des Blitzes das Motiv beleuchtet und dessen Bewegungen teilweise einfriert.
Blendenöffnung
Die Blendenöffnung bestimmt die Lichtmenge, die durch das Objektiv gelangt, indem sie den bildwirksamen Linsenquerschnitt verändert. Je größer bzw. kleiner die Blendenöffnung, desto geringer bzw. weiter die Schärfentiefe. Im ersten Fall wird der Hintergrund unscharf, im zweiten Fall scharf. Die Blendenwerte (F) verhalten sich umgekehrt zur Blendenöffnung: Je kleiner der Blendenwert, desto größer die Blendenöffnung (und umgekehrt).
Bildwinkel
Der von einem Objektiv erfasste horizontale Winkel eines Bildes. Je größer der Bildwinkel, desto breiter das Bild.
Blitzleitzahl
Wert für die maximale Lichtabgabe eines Blitzgeräts (bezogen auf ISO 100): Kameraeigene Blitze liegen im Bereich bis 20, kompakte Blitzgeräte bis 40 und Stabblitze bis 60. Je höher die Zahl, umso heller.
Bildebene
Entspricht der Film- bzw. Sensorebene. Hier ermöglicht die Bündelung der Lichtstrahlen durch die Linsen im Objektiv die Entstehung eines scharfen Bildes.
Belichtungsautomatik
(AE) Der in der Kamera eingebaute Belichtungsmesser bestimmt automatisch die Belichtung. P: Die Kamera wählt sowohl Blende als auch Verschlusszeit. A: Bei vorgewählter Blende wählt die Kamera automatisch die geeignete Verschlusszeit. S: bei vorgewählter Verschlusszeit bestimmt die Kamera automatisch die geeignete Blende.
Belichtungsautomatik mit Verschlusszeitvorwahl
(S) Bei vorgewählter Verschlusszeit bestimmt die Kamera automatisch die geeignete Blende, um eine einwandfrei belichtete Aufnahme zu erhalten. Ideal, wenn es z.B. für Aufnahmen von bewegten Objekten auf eine kurze Belichtungszeit für eine gestoppte Bewegung ankommt und die selektive Steuerung der Schärfentiefe weniger entscheidend ist.
Belichtung
Die Belichtung wird durch die bei der Aufnahme zur Verfügung stehende Lichtmenge bestimmt. Die verfügbare Lichtmenge wird durch die Blendenöffnung (in das Objektiv einfallendes Licht) und die Verschlusszeit (wie lange der Verschlussvorhang geöffnet ist) gesteuert.
Belichtungszeit
Siehe Verschlusszeit.
Belichtungsreihen
(Bracketing) Bieten sich in Situationen mit starken Kontrastumfängen an, wo die Entscheidung in der Aufnahmesituation schwierig ist, ob man auf Details in den hellen oder dunklen Bereichen verzichten will. Deshalb bietet es sich an, eine Reihe von Aufnahmen zu machen, wo neben der korrekten Belichtung eine hellere [vgl. Überbelichtung] und eine dunklere [vgl. Unterbelichtung] gewählt wird (Belichtungskorrektur). Dabei kann in ganzen Schritten (± 1 EV oder mehr) oder in kleineren Schritten (± 1/3 EV oder ± 1/2 EV) vorgehen. Der Unterschied zwischen den Aufnahmen sollte nicht zu groß sein. [Vgl. EV.] Bracketing leitet sich übrigens von bracket (= Klammer, Bereich) ab.
Bajonett
Anschluss für Wechselobjektive. Unglücklicherweise kocht jeder Hersteller sein eigenes Süppchen. Damit aber nicht genug: Selbst verschiedene Serien vom gleichen Hersteller sind oft nicht untereinander kompatibel.
Autofokus
(AF) Automatische Scharfstellung. [Vgl. Fokus.]
A
Auf der Programmwahlscheibe kennzeichnet das A die Belichtungsautomatik mit Blendenvorwahl. Abkürzung von Aperture (=Blende).
Aufnahmebereich
Bereich, in dem eine Scharfstellung des Motivs möglich ist. Ist abhängig vom Objektiv und reicht vom Mindestabstand (sog. Nahgrenze) der entweder auf dem Entfernungsring angegeben oder im Datenblatt des Objektivs vermerkt ist bis Unendlich.
AE
(Auto Exposure) Belichtungsautomatik. Oft auch die Bezeichnung für vollautomatische Programme (P).
AEL
Belichtungs-Messwertspeicherung.
Apochromatisch korrigierte Linsen
Lichtstrahlen werden durch apochromatische Linsen so gebrochen, dass die roten, grünen und blauen Lichtwellen exakt im selben Punkt auf der Film-/Sensorebene auftreffen. Somit werden chromatische Aberrationen verhindert.[Vgl. Licht.]
Abschattung
Siehe Vignettierung.
Abblenden
Schließen der Blende um eine oder mehrere Stufen.