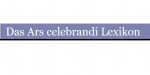Kopie von `Kath.de`
Die Wörterliste gibt es nicht mehr oder die Website ist nicht (mehr) online.
Nachstehend finden Sie eine Kopie der Informationen. Eventuell ist die Information nicht mehr aktuell.
Wir weisen Sie darauf hin, bei der Beurteilung der Ergebnisse kritisch zu sein.
Kategorie: Religion und Philosophie > Kunst des Zelebrierens
Datum & Land: 23/04/2013, De.
Wörter: 24
actuosa participatio
Die tätige Teilnahme Anders als ein Film oder ein Theaterstück macht ein Ritus die Menschen nicht nur zu Zuschauern, sondern zu Teilnehmern. Zwar lassen ein Film oder ein Theaterstück den einzelnen auch nicht unberührt. Wenn er sich mit dem Helden, der Heldin identifizieren kann, „geht“ er innerlich mit. In der Messe soll er aber selbst aktiv werden, denn im Gottesdienst wird nicht wie bei einem Jesusfilm oder der Matthäuspassion das Lebensschicksal Jesu dargestellt, sondern die Akteure sind die Gläubigen. Es geht zwar auch um die Wandlung von Brot und Wein, aber dies zielt auf die Wandlung jedes einzelnen. Er soll tiefer an das Heilswerk Gottes herangeführt werden, glauben können (Predigt) und Christus-förmig werden, um möglichst wie Christus zu denken, zu fühlen und zu handeln. Im Mittelalter, als der Aufbau der Messfeier nicht mehr gut verstanden wurde, hat man versucht, im Ablauf der Messe einzelne Begebenheiten aus dem Leben Jesu wieder zu erkennen. Aber der Messritus stellt nicht den Lebensweg Jesu dar, dieser wird, über das Jahr verteilt, durch die Lektüre eines Evangeliums vergegenwärtigt. In der Messe geht es um Wandlung der Nicht-Glauben-Könnenden zu Glaubenden, von einem, dem das Herz verschlossen ist, zu einem mit einem großen Herzen, von einem, der sich nicht traut, von Jesus zu sprechen, zu einem Zeugen Gottes, der in Jesus die Menschheit gerettet hat. Die tätige Teilnahme ist notwendig, damit der Glaubende verwandelt wird. Er begrüßt im Kyrie Jesus Christus und dann wieder im Halleluja-Gesang den im Wort des Evangeliums gegenwärtigen Christus, er stimmt, nachdem er durch die Lesungen und die Predigt tiefer in den Glauben eingeführt wurde, im Credo in den Glauben der Kirche ein. Bei der Gabenbereitung trägt er, indem er Geld in den Kollektenkorb legt, zum Leben und dem sozialen Engagement der Gemeinde bei. Im Sanctus- und Agnus-Dei-Gesang preist er Gott. Im Vater-Unser rekapituliert er das Hochgebet, um dann im Empfang des gewandelten Brotes Christus zu begegnen und sich dann, gestärkt, zu seinem Dienst und zur Verkündigung der Frohen Botschaft in die Welt zurückschicken zu lassen. Wie ermöglicht der Zelebrant diese aktive Teilnahme? Er muss der in der römischen Liturgie enthaltene Dramaturgie folgen.
Höhepunkt-Messe
Ist die Wandlung der Höhepunkt? Sie ist es noch immer im Empfinden vieler Katholiken. Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass sich viele nicht würdig fühlen, den Leib Christi in der Gestalt des gewandelten Brotes zu empfangen. Es liegt aber auch in der Frömmigkeitsentwicklung des Mittelalters begründet, die wir in den gotischen Kirchen noch sehen können. Die Kirchen sind voller Bilder, in den Glasfenstern, als Wandmalereien, Gemälde und Skulpturen. Auch die Messgewänder waren reich bestickt, selbst der Altartisch wurde mit Figuren ausgestattet. Die Menschen im Zeitalter der Gotik wollten „sehen“. Deshalb hob der Priester nach den Wandlungsworten die Hostie und den Kelch über seinen Kopf. Da er mit dem Rücken zu der Gemeinde zelebrierte, konnte er so das gewandelte Brot und den Kelch den Gläubigen „zeigen“. Die Scheu, zur Kommunion zu gehen, wurde erst Anfang des 20. Jahrhunderts durch die Initiative von Papst Pius X. überwunden. So löst die katholische Kirche wieder den Auftrag ein, den Jesus ihr mitgegeben hat, das Brot zu essen und den Wein zu trinken. Im Johannesevangelium betont Jesus die Notwendigkeit, das gewandelte Brot nicht nur anzuschauen, sondern zu essen: „Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, (ich gebe es hin) für das Leben der Welt. Da stritten sich die Juden und sagten: Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen, das sage ich euch: Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am Letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm.“ Johannes 6, 51-56, Der Höhepunkt liegt also wie bei jeder gelungenen Dramaturgie kurz vor dem Ende, denn die Messe führt den einzelnen zu einer direkten Begegnung mit Christus. Diese Begegnung vollzieht sich aber nicht für den einzelnen allein. Auch gehört er nicht nur zur Gemeinschaft der Glaubenden, die sich zur Feier der Messer versammelt haben, sondern er ist auch mit der Gemeinschaft der Heiligen verbunden, die die himmlische Liturgie feiert. So sind die Kirchenräume deshalb mit der Darstellung von Heiligen ausgestattet, weil diese mit den Gläubigen feiern. Im Sanctus stimmt die Gemeinde ausdrücklich in den himmlischen Gesang mit ein.
Wechselgesang
Die Messfeier kennt eine Grundstruktur für die Gesänge, den Wechselgesang zwischen Vorsänger oder Vorsängergruppe einerseits und der Gemeinde andererseits. Das katholische Kirchenlied ist nicht das von der Orgel begleite Volkslied. Die liturgischen Gesänge in katholischer Tradition, so wie sie in Frankreich und vielen anderen Ländern neu belebt wurden, überlassen die schwierigeren Teile dem Vorsänger oder einer Gruppe (Schola) und die Refrains der Gemeinde. Der Wechselgesang gibt dem Gottesdienst einen Rhythmus, der durch das aus protestantischer Tradition herkommende Kirchenlied eher eingeebnet wird. Für das Liedprogramm einer katholischen Eucharistiefeier sind zwei Grundmuster zu beachten, die fast alle als Wechselgesänge konzipiert sind: 1. Begleitgesänge zu den Prozessionen, also - Eingangslied zum Einzug der Altargruppe; - Hallelujagesang zur Evangelienprozession; ist auch eine Wechselgesang! - Gabenlied zur Gabenprozession, das mit dem Ankommen der Prozession am Altar endet. - Kommuniongang, hier eignet sich ein einfacher Refrain. - Auszug – Lied, das das „Ite Missa est“, “Ihr seid gesandt“ aufgreift. Im gregorianischen Choral entspricht- der Introitus der Einzugsprozession - das Halleluja der Evangelienprozession - das Offertorium der Gabenprozession - die Communio dem Kommuniongang 2. Liturgische Gesänge - Kyrie - Gloria - Zwischengesang - Credo – gesungenes Glaubensbekenntnis - Sanctus - Agnus Dei (zum Ritus des Brotbrechens) In der Gregorianik sind für diese Gesänge die verschiedenen Messen, z.B. Missa de Angelis, vorgesehen, die jeweils im Wechsel gesungen werden. Die Messen, die im Barock, in der Klassik und bis heute für Chor und Orchester komponiert wurden, vertonen die liturgischen Gesänge, haben jedoch nicht wie die mittelalterliche Kirchenmusik ein Repertoire für die Begleitung von Prozessionen geschaffen. Orte der MusikDer Wechselgesang erfordert, dass Vorsänger bzw. Schola im Chorraum bzw. seitlich zum Altar im vorderen Teil der Kirche stehen. Die Grundkonzeption der katholischen Musiktradition erfordert allenfalls eine kleine Orgel im Chorraum, auf jeden Fall jedoch Vorsänger und eine Schola. Die Orgel auf der Empore hat eigentlich in der, nach dem II. Vatikanischen Konzil erfolgten, Überarbeitung des Messritus keine Funktion. Sie kann bei Orchestermessen eingesetzt werden und zur Begleitung von Liedern, die einen eigenen Stellenwert im Gottesdienst haben sollen (Kirchlied). Die Option, dass der Gottesdienst nicht wie bei einer Orchestermesse eine Schauspiel ist, dem die Gläubigen mit Andacht folgen oder das sie mit eigenem Rosenkranzgebet füllen, sondern dass eine aktive Mitfeier ermöglicht werden soll, entspricht der Wechselgesang sehr viel mehr als das von einer im Hintergrund, nicht selten zu laut begleitenden Orgel gesungene Kirchenlied.
Vater, Sohn, Heiliger Geist
Die Eucharistiefeier ist nicht nur das Gedächtnismahl Jesu, durch das er mitten in der Gemeinde mit seinem Wort und in Leib und Blut in den Gestalten von Brot und Wein gegenwärtig ist. Auch wenn der Wortgottesdienst in der Verlesung des Evangeliums von Jesus seinen Höhepunkt findet, ist Jesus Christus nicht der einzige, von dem gesprochen wird. Gerade die Evangelien bringen an vielen Stellen die enge Beziehung Jesu zum Vater zum Ausdruck. Die Eucharistiefeier wendet sich daher als Dank an den Vater, durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Sie nimmt die feiernde Gemeinde mit in das innere Verhältnis Gottes und führt, wie Jesus es wollte, die Menschen im Heiligen Geist zum Vater. Die Eucharistie, die Dankfeier, richtet sich an den Vater, der seinen Sohn nicht geschont, sondern in seinem Sterben und seiner Auferstehung die Erlösung für alle Menschen gewirkt hat. Diese Grundstruktur kommt im Wortteil der Messe bereits zum Tragen. Das dreiteilige Kyrie richtet sich z.B. nicht an den Vater, den Sohn und den Geist, sondern an Christus, ebenso das Halleluja, das den im Symbol des Evangelienbuchs einziehenden Christus begrüßt. Das Tagesgebet richtet sich an den Vater. Im Glaubensbekenntnis und in der Präfation wird dann ausdrücklich der Vater angesprochen. Vor den Wandlungsworten, die über Brot und Wein gesprochen werden, wird der Heilige Geist angerufen. Die abendländische Eucharistiefrömmigkeit hat den Empfang der Kommunion als Christusfrömmigkeit akzentuiert. Dass Jesus die Menschen zum Vater führen will, zeigen die Abschiedsreden, die das Johannesevangelium im Zusammenhang Mahles Jesu mit seinen Aposteln überliefert. Dieser Grundgedanke kann in Kommunionmeditationen und Liedern aufgegriffen werden. Der Zelebrant kann mit wenigen Worten die Eucharistiefeier christologisch „engführen“ oder aber in eine trinitarische Sicht der Liturgie einbetten. Das kann auch dadurch geschehen, dass die Verschränkung der irdischen Liturgie mit der himmlischen angedeutet wird.
Tagesgebet
Der Eröffnungsteil der Messe wird durch das Tagesgebet abgeschlossen. Die Elemente- „Einstimmung auf das Erlöstwerden“, - Anrufung des auferstanden Christus im Kyrie-Ruf, die Erweiterung des Kyrie-Rufes durch - das Gloria werden „eingesammelt“ Deshalb hieß das Tagesgebet früher auch Collecta, von colligere, einsammeln. Es sind aber auch die persönlichen Gebete der einzelnen, die der Zelebrant „einsammelt“. Deshalb soll nach der Einleitung „Lasset uns beten“ eine größere Pause den Gläubigen die Möglichkeit geben, ihre Bitten still zu sprechen, die der Zelebrant dann mit dem Tagesgebet abschließt.
Taufe
Die Dramaturgie der Taufe In einer Ars celbrandi kommt es drauf an, den Höhepunkt zu inszenieren. Bei der Taufe geht man davon aus, dass das Eintauchen in bzw. das Übergießen mit Wasser den Höhepunkt markiert. Wenn die taufe so inszeniert wird, verlieren die nachfolgenden Zeichen ihre Kraft. Sicher ist das Wasser das zentrale Zeichen, aber die Gebete wie auch die biblischen Texte bezeichnen das Wasser als Krise. Bereits in den vorausgehenden Gebeten und in dem Glaubensbekenntnis wird der Gegensatz zwischen dem Bösen und dem Urheber alles Guten, Gott, intoniert. Das Wasser symbolisiert den Durchgang durch eine Krise, der Mensch soll dem Bösen sterben und zum Leben, das Gott als ewiges Leben schenkt, auferstehen. Wie in der Eucharistiefeier hat der Wortteil der Taufe die Funktion, die Krise zu benennen. Das Wasser und die anderen Symbole verlieren ihre Kraft, wenn die Taufe als harmonische Familienfeier dargestellt und die Krise unterschlagen wird. Gut und Böse, Tod und Leben, um die es letztlich im menschlichen Leben geht, stellen nicht nur den Täufling vor grundlegende Entscheidungen, sondern alle Feiernden. Wenn die Lösung der Krise schon am Beginn thematisiert wird, erzeugt die übliche Taufpraxis genauso wie die meisten Eucharistiefeiern den Eindruck, es sei sowieso alles in Ordnung, ob man sein Kind nun taufen lässt oder nicht, ob man am Sonntag die Messe mit feiert oder nicht. Die Taufe sagt nun, trotz aller Glättungen der Liturgiereform, dass die Ordnung und damit das Leben bedroht sind, dass es auf eine Entscheidung ankommt. Der Mensch muss sich angesichts der Tatsache des Bösen entscheiden. Diese Entscheidung sollte durch die Predigt vorbereitet werden, damit sie im Vollzug des Untertauchens bzw. Übergießens geschehen kann. Wenn der Täufling bei der Berührung mit dem Wasser schreit, ist das genauso wenig falsch wie wenn die Brautleute beim Ja-Wort und dem Anstecken der Ringe sehr erregt sind. Wenn aber der Wasserritus erst den Durchgang durch die Krise darstellt, auf welchen Höhepunkt läuft der Taufritus dann hin? Am Bespiel des Durchzugs durch das Rote Meer kann sich der Zelebrant die weitere Inszenierung verdeutlichen: Es wird der Sieg über die bösen Mächte gefeiert. Moses, der das Volk durch das Rote Meer trockenen Fußes geführt hat, spricht ein Dankgebet und feiert mit dem jüdischen Volk ein Opfer. In der Taufe wird der Durchgang zum Leben in der Salbung mit Chrisam gefeiert. Der Getaufte ist jetzt Teil des königlichen und priesterlichen Volkes Gottes. Er wird sogar neu eingekleidet und erhält eine Kerze. Entsprechend den vier dramatischen Schritten gliedert sich die Taufe: Benennung der Krise Wortteil mit Lesung und Predigt Durchgang durch die Krise Dem Bösen widersagen, Wasserritus Feier der durchgestandenen Krise Salbung mit Chrisam, Taufkleid Entlassung und Sendung Übergabe der Kerze und Segen Die Zuordnung der einzelnen Symbolhandlungen zu den vier Schritten eines Ritus zeigt, wie kunstvoll der Taufritus gestaltet ist. Die Feierkunst hält sich an diese Vorgabe, indem sie den einzelnen Symbolen ihren Platz gibt und den Bogen nicht nach der Wassersymbolik sich verlaufen lässt, indem die anderen Riten einfach angehängt werden. Der Bogen muss bis zur Übergabe der Kerze und dem Segen über Mutter und Paten gespannt werden. Dieser Bogen entwickelt sich in den Herzen der Feiernden nur, wenn die zentrale Aussage des Wortteils der Taufe, nämlich die Entscheidung zwischen Tod und Leben, deutlich herausgearbeitet wird.
Prozession
Prozession als Grundstruktur Die Messe, die seit der öffentlichen Anerkennung des Christentums durch Kaiser Konstantin gefeiert wurde, fand nicht mehr in Hauskreisen statt, sondern öffentlich, in der Basilika, der Königshalle, dem kommunalen Versammlungsraum. Dieser Raum legte es nahe, ein religiöses Ritual aufzugreifen, das auf allen Kontinenten anzutreffen ist: Die Prozession. Da die Kirchen bald so gebaut wurden, dass im Osten der Zielpunkt der Prozession erreicht wurde, schreitet die Altargruppe mit dem Bischof bzw. Priester als Letztem vom Abend, vom Westen her, der aufgehenden Sonne entgegen. Die aufgehende Sonne symbolisiert den auferstandenen Christus. Der Eingangsprozession entsprechen der Auszug und vorher die Sendung der Gläubigen in die Welt zurück, die sie, ebenfalls mit Durchgang durch das Westportal, wieder betritt. Drei weitere Prozessionen, vor der Messreform im 16. Jahrhundert waren es wahrscheinlich noch viel mehr, gliedern nicht nur den Ablauf der Eucharistiefeier, sondern heben auch Höhepunkte heraus: Die Evangeliumsprozession, vom Halleluja-Gesang begleitet, gibt dem Evangelium einen besonderen Platz. Die Gabenprozession leitet den eucharistischen Teil, die Mahlfeier ein. Die Kommunionprozession führt den einzelnen zu einer persönlichen Begegnung mit Christus in der Gestalt des gebrochenen Brotes. Das Ritual der Prozession bietet der versammelten Gemeinde die Möglichkeit, in dem ursprünglich weltlichen Rahmen der Königshalle eine Liturgie zu feiern. Seit der Romanik sind die Kirchen noch deutlicher als Sakralräume gestaltet, so dass die Frage entsteht, ob man nicht auf die Prozessionen verzichten sollte. Man sollte nicht, denn erst mit dem Einzug sammelt sich die Gemeinde auf den Altar hin, durch die Evangelienprozession wird vermieden, dass der Wortteil der Eucharistiefeier zur Katechese wird. Die Gabengang zeigt, dass ein Mahl beginnt. Das ist deshalb notwendig, weil Brot und Wein als sinnliche Zeichen nicht mehr so wirken wie bei einer Hausmesse. Sie müssen daher herausgehoben werden – durch eine Prozession. Der Kommuniongang sollte bewusst gestaltet werden, damit die Gläubigen sich auf die Begegnung mit Christus konzentrieren können. Die Prozessionen sind kein typisch christliches Ritual, sie sind aber als Lösung zu sehen, eine Liturgie zu gestalten und die Menschen auf das Evangelium, die Vorbereitung des Mahles und die Begegnung mit Christus zu konzentrieren.
Predigt
In der protestantischen Tradition kommt der Predigt nicht zuletzt deshalb eine herausragende Bedeutung zu, weil diese Konfession in der intensiven Auseinandersetzung mit dem biblischen Text ihre Wurzeln hat und weil sie sich deutlich von der Betonung des Rituellen und Sakramentalen durch die mittelalterliche Kirche unterscheiden wollte. Da der Zelebrant in der Predigt seine wichtigste Vorbereitung auf einen Gottesdienst sieht, kann es auch in der katholischen Eucharistiepraxis zu einer Betonung der Predigt kommen, die ihrem Platz im Ablauf der Messe nicht entspricht. Als noch ein gesundes Gefühl für die Dramaturgie der Messfeier bestand, wurden die Fastenpredigten außerhalb der Messfeier gehalten, denn diese Predigten griffen ein Thema grundsätzlich auf und hatten nicht die Funktion, zur Feier der Eucharistie hinzuführen. Um die Funktion der Predigt schon bei der Vorbereitung einer Messe richtig zu sehen, hilft ein Blick auf die Überlieferung von den zwei Emmausjüngern. Ihre Begegnung mit Jesus gipfelt im Brotbrechen, eine altchristlicher Name für die Eucharistiefeier. Erst-Aufgabe des Predigers ist es also nicht, die Lesungstexte zu erschließen, sondern mit Hilfe der biblischen Texte die Gemeinde auf die Begegnung mit Christus in den Gestalten von Brot und Wein vorzubereiten. Wie in der Emmausgeschichte stützt sich die Predigt auf die Texte, aber es geht nicht um die Texte, sondern um den Glauben der Feiernden, dass sie Gott wieder tiefer vertrauen und erkennen, dass der Weg Jesu, der Weg durch Anfeindung, Schmerzen, Verachtung und Hingabe des eigenen Lebens nicht ins Nichts führt, sondern in das neue Leben. Die Predigt lenkt die Begegnung mit Gott im Wort auf das große Dankgebet, das mit der Präfation beginnt, und in das die Worte über Brot und Wein eingebettet sind. Eine Frage kann die Predigtvorbereitung leiten: Hilft die die Auseinandersetzung mit den Texten der feiernden Gemeinde zu einem tieferen Dank über die geschenkte Erlösung? Die Predigt hat natürlich auch für das Verständnis der Texte eine unaufgebbare Funktion. Sie zeigt auf, wie Gott das Heil der Menschen wirkt. Im Unterschied zu einer Wort-Gottes-Feier weitet die Predigt in der Messe den Blick auf die Feier der Eucharistie aus, sie legt nicht nur den Text auf die Situation der Gläubigen hin aus.
Pausen
(und Längen) Pausen haben dramaturgisch die Funktion, etwas zu betonen. Betont wird das, was nach der Pause kommt. Ein Thriller ohne solche dramaturgisch eingesetzten Pausen ist undenkbar. Wird die Pause dramaturgisch nicht richtig eingesetzt, wird sie einfach zur leeren Zeit und wirkt nur als unnötige Länge oder, noch schlimmer, die Feiernden haben das Gefühl, der Zelebrant habe den Faden verloren. Da ein Gottesdienst nicht mit Spannungselementen wie ein Film arbeitet, lenken Pausen meist von der Feier ab. Denn auch der Ablauf der Messe ist so angelegt, dass etwas geschieht, aber es werden keine Spannungselemente eingesetzt: Ein Lied setzt ein, eine Lesung beginnt, die eucharistischen Gaben werden erhoben, die Menschen gehen nach vorne, um die hl. Kommunion zu empfangen. Wenn vor diesen Einsätzen Pausen eingefügt werden, entsteht keine Spannung. Blättert die Lektorin im Lektionar, schaut sie den Text noch mal an, als hätte sie sich nicht vorbereitet, schaut sie auf und dann wieder ins Buch, entsteht keine Spannung, sondern nur das Gefühl: „Warum fängt sie nicht endlich an!“ Denn jeder weiß, dass eigentlich jetzt die Lesung zu Gehör gebracht werden sein soll. Für die Aufmerksamkeit der Gemeinde wäre es am besten, das Lektionar wäre aufgeschlagen oder, wenn es aufgeschlagen wird, liegt das Band in der richtigen Seite, ohne dass sich die Lektorin vergewissert, ob sie auch die richtige Lesung lesen wird. Sie sollte vielmehr auf die hintersten Bänke schauen, die dort Sitzenden zum Zuhören gewinnen und dann anfangen. Kürzere Pausen gliedern den Text in Sinnabschnitte, so wie die Texte im Lektionar gesetzt sind. Nach der Lesung betont eine kurze Pause die Bedeutung des Gelesenen. Es wird nicht gleich das „Wort des Herrn“ angeschlossen, als gehörte dieser Ruf zur Lesung. Ein Beispiel, wie Pausen die Spannung erhalten, ist das Psalmengebet. Wenn der Psalm im Wechsel gebetet wird, dann wird die Pause nicht am Ende, sondern in der Mitte zwischen zwei Versen eingehalten, der Wechsel von einem Chor der Beter zum anderen geschieht ohne Pause, denn diese Pause würde als Verzögerung und damit als Länge erlebt. Länge der PausenAm besten, Lektoren, Fürbittsprecher und der Zelebrant machen Pausen im Rhythmus des Ein- und Ausatmens. Einmal ein- und ausatmen ist eine gute Pause. Orte für Pausen EröffnungNach der Einladung zum Sündenbekenntnis zwei Atemzüge. Vor dem Tagesgebet nach dem „Lasset uns beten“ zwei Atemzüge, denn es wird ja eine Gebetsaufforderung ausgesprochen. WortteilVor dem „Wort des lebendigen Gottes“ und „Evangelium unseres Herrn Jesus Christus“ ein Atemzug. Wenn das Evangeliar nach dem Verlesen an einen Platz gebracht wird, ist keine weitere Pause nötig, sonst zwei Atemzüge. Nach der Predigt hat eine längere Pause Platz. Damit sie nicht durch Hüsteln ungeduldiger Gottesdienstbesucher abgebrochen wird, sollte sie mit Musik unterlagt sein. EucharistieteilNach den Fürbitten sollte zuerst der Altar bereitet werden. Währenddessen bleibt der Zelebrant sitzen. Wenn die Gaben zum Altar gebracht werden, steht er auf. Für das Hochgebet sind Pausen zwischen den einzelnen Gebeten und beim Gedächtnis innerhalb des Gebetes der Verstorbenen von einer Atemlänge angemessen. Die Pause zum Abschluss des Hochgebets folgt nach dem „Durch ihn …“ so dass vor der Einleitung zum Vaterunser eine Pause liegt. Dann erfüllt das Vaterunser seine Funktion, die Gemeinde rekapituliert das im Hochgebet gepriesene Erlösungswerk und führt es fort! KommunionteilEigentlich wird der Vers zur Communio als Antiphon von den Gläubigen gesungen, weil die Verse so ausgewählt sind, dass sie die innere Einstellung zum Ausdruck bringen, mit der die Gläubigen Christus in der Gestalt des Brotes begegnen. Wenn die Gläubigen an ihren Platz zurückgehen, brauchen sie eine Unterstützung für das stille Gebet. Das kann ein Orgelstück sein, das nicht zum Zuhören zwingt, sondern mitgehört werden kann. Die Reinigung der Gefäße ist kein Teil der Messe, die Pause, die mit der Kelchreinigung häufig gemacht wird, zerstört den Rhythmus des Kommuniongangs, denn sie macht die Reinigung wichtiger als den Kommunionempfang, einfach weil sie, wenn sie nicht durch ein Lied überdeckt wird, durch die lange Pause eine deutliche Betonung des Putzens herstellt. Reinigen und Abräumen der Geräte wird durch die lange Pause deutlicher betont als der Kommunionempfang. Daher sollte die Reinigung der Gefäße nach der Messe erfolgen. Aus Pausen werden LängenLängen entstehen durch falsch gesetzte Pausen. Wenn z.B. der Priester an seinem Sitz, der Lektor am Ambo angekommen sind und nicht anfangen. Das Gefühl der Länge entsteht auch, wenn der Priester am Priestersitz angekommen ist und die Gemeinde nicht begrüßt, sondern erst jetzt das Eingangslied intoniert wird. Damit wird die Feier schon am Anfang gedehnt und die Spannung der Gläubigen sinkt. Bei Festveranstaltungen geht der Redner auch nicht ans Pult, um dann zu warten, bis das Trio sein Stück beendet hat, sondern er geht erst ans Pult, wenn die Musik verklungen ist. Wartet der Zelebrant mit den Gebeten über die Gaben, bis die Kollekte abgeschlossen ist, entsteht keine Länge, sondern Dynamik und Konzentration auf den beginnenden Eucharistieteil. Wartet der Organist aber nach der Kommunion mit der Intonation des Dankliedes, bis Ziborien und Kelch gereinigt sind, dann wird daraus keine dynamische Pause, sondern das Gefühl „hoffentlich ist er bald mit seinem Putzen fertig“. Die Reinigung der Gefäße sollte entweder so kurz sein, dass keine Pause entsteht oder sollte nach dem Gottesdienst erfolgen, jedenfalls nicht am Altar. Sonst wird der Altar zum Spültisch.
Messe oder Katechese
Es gibt seit der Einführung der Liturgie, die nach dem II. Vatikanischen Konzil erarbeitet wurde, ein ständiges Unbehagen an der reformierten Messe. Nicht nur konservative Katholiken, sondern auch Psychotherapeuten und Schriftsteller wie Martin Morsebach kritisieren die neue Liturgie. Was ist der Stein des Anstoßes? Die neue Liturgie an sich ist erst einmal eine Verbesserung. In der Landessprache können die Gläubigen sehr viel einfacher mitfeiern, es gibt eine größere Auswahl an biblischen Lesungen, überhaupt ermöglicht die neue Liturgie eine aktivere Beteiligung der Gläubigen. Was verursacht dann aber das Unbehagen? Es ist eine grundlegende Veränderung, die unter der Hand geschehen ist, von Liturgen wie Bischöfen nicht bemerkt, jedoch mit gravierenden Folgen, die sich im Rückgang des Gottesdienstbesuches zeigen: Aus der Messe ist eine Katechese mit angehängtem Ritus des Brotbrechens geworden. Das Erklären verstellt den Ritus Diese Umwidmung der Messe, die aus einem Gottesdienst eine Unterrichtsstunde macht, geschieht, ohne dass an dem liturgischen Ablauf etwas geändert werden musste. Die grundlegende Veränderung bleibt auch deshalb unbemerkt, weil die katholische Kirche sich der Moderne in ihrem Innersten angepasst hat. Sie traut nicht mehr ihren Riten, sondern ist mit der Moderne überzeugt, dass man erst erklären muss, ehe man teilnehmen kann. Das Erklären wird bei Theateraufführungen und Konzerten ebenso praktiziert. Das war in der frühen Kirche anders. Es gab sehr wohl eine lange Einführung, die ganze Fastenzeit wurden die Katechumenen mit den Inhalten des Glaubensbekenntnisses vertraut gemacht und so auf die Taufe vorbereitet. Der Taufritus wurde jedoch nicht vor der Taufe erklärt, sondern erst nach der Osternacht, wenn die Taufe bereist geschehen war. Jetzt wird alles erklärt, aus Herzensbildung wird Verstandesbildung. Um was geht es aber der in die Messe verlegten Erwachsenenbildung. Es sollen die Erkenntnisse der Bibelwissenschaften den Gläubigen nahe gebracht werden. Man kann die Lesungen nicht mehr einfach verstehen, sondern sie müssen es wissenschaftlich erläutert werden. Hat der Gottesdienstbesucher die Katechese absolviert, so wird kann er noch an dem eucharistischen Mahl teilnehmen. Dass aber die Predigt die Lesungen mit dem eucharistischen Mahl verbinden soll, ist in Vergessenheit geraten. Da die Auslegung des Textes alle Kräfte beansprucht, wird die Lesung nicht mehr auf die Lebenswelt bezogen und auch kaum mit dem konkreten Leben der Menschen verbunden. Dass die Messe zu einer Unterrichtsstunde umfunktioniert wurde, ist an vielen kleinen Veränderungen zu erkennen. Einleitung wie in eine Religionsstunde Nach der Reform, die vom II. Vatikanischen Konzil angeregt wurden, ist nicht nur das Latein durch die Volkssprachen abgelöst worden, die Messe ist vieler ihrer ritueller Elemente beraubt: Es gibt keine feierliche Eröffnung, am Sonntag wird die Besprengung mit Weihwasser nicht mehr durchgeführt. Stattdessen beginnt der Zelebrant mit einer Einführung in die „Schulstunde“, indem er einen Ausblick auf Lesungen und Evangelium gibt und schon andeutet, wie er die Texte interpretieren wird. Wer verschiedenen Kirchen in Deutschland besucht, wird fast nie in der Eröffnung hören, dass man sich zum Gedächtnismahl trifft, das Jesus den Aposteln anvertraut hat. Vielmehr beginnen die meisten Zelebranten etwa so: Wir hören heute im Evangelium, das Jesus von dem kranken Glauben fordert.“ Meist wird daraus ein Sündenbekenntnis abgleitet: „Deshalb bitten wir Gott um Verzeihung, wo wir zu wenig geglaubt haben.“ Meist ist der Bogen der Predigt auch so angelegt, dass den Zuhörern eine Anwendung für das eigene Leben eröffnet wird. Das ist sicher sinnvoll. Aber warum sollen die Gläubigen noch zum eucharistischen Teil des Gottesdienstes bleiben, wenn doch schon „alles gesagt ist“ und die Predigt keinen Bogen zum Dankgebet (so ist das griechische Wort „eucharistia“ zu übersetzen) spannt. Die Fürbitten zeigen, wohin der Bogen gespannt wird: Gott wird um etwas gebeten. Sicher auch nicht falsch, aber soll der Wortteil der Messe nicht zum Dank hinführen. Solange der eucharistische Teil der Messe nicht einen höheren Stellenwert bekommt und der Zelebrant schon vom ersten Moment an den Blick auf die Eucharistie, die Danksagung und das Lob Gottes lenkt, wird die katholische Messe weiter verkümmern und es wird wahrscheinlich eine Rückkehr zur tridentinischen Messe geben, denn diese ist unverwechselbar Gottesdienst und keine Katechese, d.h. Unterrichtung über die Inhalte der Lesung, also Sonntagsschule. (Tridentinische Messe wird die nach dem Trienter Konzil reformierte Messe genannt, die nur in Latein gefeiert wurde und den Gläubigen kaum Beteiligungsmöglichkeiten eröffnete.) Die Orgel schiebt von hinten Auch die musikalische Tradition ist aufgeben worden. Das Kryrie, mit dem die Gemeinde feierlich ihren Herrn, Christus begrüßt, wird ebenso gesprochen wie das Glaubensbekenntnis, obwohl die Tradition bis zu Schubert und Bruckner immer das gesungene Credo (Ich glaube) kennt. Eine Schulklasse gibt auch keine gesungene Antwort auf die den Unterricht. Da der Musiker hinter der Gemeinde auf der Empore die Orgel spielt, hat er nur dieses Instrument, um den Gemeindegesang zu leiten. Dieser war aber ursprünglich ein Wechselgesang. Vorsänger oder eine kleine Schola singen die anspruchsvolleren Melodien. Sie stehen vorne und können so den Gesang dirigieren, die Orgel kann nur „schieben“. Da in Deutschland vor dem Gottesdienst kaum noch Lieder eingeübt werden, reduziert sich das Repertoire auf 20 bis40 Nummern des Gebetbuches.
Messopfer
Mit dem Opfer tritt der Mensch in eine nahe Beziehung zu Gott. Indem der Mensch etwas Wertvolles verbrennt, übereignet er es Gott. Ist der Zelebrant einer Messe damit ein Opferpriester und muss die Messe überhaupt als Opfer inszeniert werden? Nach christlicher Überzeugung gibt es kein weiteres Opfer mehr, nachdem Jesus am Kreuz sein Leben hingegeben hat. Der Hebräerbrief stellt diese Überzeugung am ausführlichsten dar: „Denn Christus ist nicht in ein von Menschenhand errichtetes Heiligtum hineingegangen, in ein Abbild des wirklichen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor Gottes Angesicht zu erscheinen; auch nicht, um sich selbst viele Male zu opfern, (denn er ist nicht) wie der Hohepriester, der jedes Jahr mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht; sonst hätte er viele Male seit der Erschaffung der Welt leiden müssen. Jetzt aber ist er am Ende der Zeiten ein einziges Mal erschienen, um durch sein Opfer die Sünde zu tilgen.Und wie es dem Menschen bestimmt ist, ein einziges Mal zu sterben, worauf dann das Gericht folgt, so wurde auch Christus ein einziges Mal geopfert, um die Sünden vieler hinwegzunehmen; beim zweiten Mal wird er nicht wegen der Sünde erscheinen, sondern um die zu retten, die ihn erwarten.“ Hebräerbrief, 9, 24-28 Aber in den Texten der Messe findet sich immer wieder der Opferbegriff. Der Altar ist ja nicht nur ein bloßer Tisch, sondern auch ein Opferstein. Ist es dann das Opfer Jesu, das auf dem Altar dargebracht wird? Die Messe hat eine innere Beziehung zum Opfer Jesu. Wenn der Priester die Worte Jesu wiederholt, die er am Abend vor seiner Hinrichtung über Brot und Wein gesprochen hat, dann hat er seinen Tod mit diesem Mahl verbunden: „Als die Stunde gekommen war, begab er sich mit den Aposteln zu Tisch. Und er sagte zu ihnen: Ich habe mich sehr danach gesehnt, vor meinem Leiden dieses Paschamahl mit euch zu essen. Denn ich sage euch: Ich werde es nicht mehr essen, bis das Mahl seine Erfüllung findet im Reich Gottes.Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und reichte es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis!Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird.“ Lukas, 22,14-16, 19-22 Es bestand lange Unsicherheit, ob in der Messe das Opfer Jesu wiederholt wird. Das wohl sicher nicht, aber es ist in den Gestalten von Brot und Wein gegenwärtig. Es ist der Auferstandene Jesus, der im Kyrie begrüßt und der in seiner Gemeinde anwesend ist. Ist der Zelebrant dann doch der, der das Opfer Jesu neu darbringt? Er verbindet das Opfer der Gemeinde mit dem Opfer Jesu. Das Opfer der Gemeinde besteht im Lob Gottes. Das bezieht sich auf eine Aufforderung des Paulus: Bringt Opfer des Lobes dar. Im Dank nähert sich die Gemeinde Gott, weshalb die Messe „Eucharistie“ – zu Deutsch „Danksagung“ heißt. Der Opfercharakter der Messe findet auch darin Ausdruck, dass die Gläubigen für die Armen und den Unterhalt der Kirche etwas spenden, indem sie Lebensmittel mitbringen oder Geld in den Klingelbeutel werfen. Dieses Opfer der Gemeinde wird im Hochgebet mit dem Opfer Christi verbunden. Dass hier der Dank und das Lob Gottes im Vordergrund stehen, zeigt bereits die feierliche Einleitung zum Hochgebet. In der Messe geht es nicht darum, zu opfern, damit wir in den Himmel kommen, sondern es geht um das Opfer Christi, für das wir danken. Er hat uns längst erlöst, bevor wir irgendein Opfer darbringen. Dafür danken wir. Weil Christus sich für uns Menschen geopfert hat, sind wir auch zum Opfer befähigt, ausgedrückt in dem Geldopfer für die Armen bis hin zum Einsatz für das Evangelium, das Martyrium. Das Wort heißt erst einmal nur „Bekenntnis für Christus“. Dass es tödlich enden kann, zeigen die vielen Märtyrer.
Lesung
Warum sollen die zum Gottesdienst Versammelten sich einen Text aus dem Propheten Jesaja, einen Abschnitt aus einem Paulusbrief oder eine Begebenheit aus der jüdischen Glaubensgeschichte anhören? Aufmerksamkeit entsteht ja, wenn die Hörer eine Erwartungshaltung haben. Damit die Gottesdienstteilnehmer von der Lesung etwas erwarten, ist die Einführung so wichtig. Wenn in der Einführung am Beginn des Gottesdienstes nur der Inhalt der Lesung angekündigt wurde, erzeugt man eher ein Weg-Hören. Denn warum soll ich hinhören, wenn ich das Entscheidende schon weiß. Die Lesung wird dann gut aufgenommen, wenn sie als erste Antwort auf eine Glaubensfrage angekündigt ist. Die Texte der Bibel werden ja deshalb immer noch angehört, weil in ihnen etwas steckt, was mit den Fragen der Menschen heute korrespondiert. Der lange Entstehungsprozess des biblischen Kanons garantiert, literarisch gesehen, dass die Texte nicht an eine Generation gebunden sind, sondern für nachfolgende Generationen immer noch interessant sind – bis zu den Bibelverfilmungen für Kino und Fernsehen. Auf diese Substanz kann der Zelebrant bauen, er muss nur in der Eröffnung anklingen lassen, welche Perspektiven der Text aufzeigt.
Kryrie eleison
Kyrie - Ruf Das Kyrie klingt wie eine Vergebungsbitte: „Herr, erbarme dich.“ Es ist aber in erster Linie ein Begrüßungsruf. Der einziehende Kaiser im römischen Reich wurde von der Menge mit „Kyrie eleison“ begrüßt. Die Christen haben den Ruf auf ihren Herrn, den auferstandenen Christus, bezogen. Das war in den ersten Jahrhunderten eine deutliche Abgrenzung, nicht den Kaiser, sondern Christus als den obersten Herrn zu bekennen. Als in den 12 Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft der Heil Hitler-Gruß erzwungen und zum Erkennungszeichen überzeugter Nazis wurde, war das Christkönigsfest eine ähnliche Gegenbewegung wie der Kyrie-Ruf der frühen Christen. Im Kyrie wird Christus ausdrücklich als in der Feier gegenwärtig begrüßt. Da das Kyrie kein Gebet um Erbarmen, sondern ein Begrüßungsruf ist, der die Gemeinde nach den Eröffnungsworten des Zelebranten auf Christus einstimmt, kann man das Kyrie eigentlich nicht „sprechen“. Das Kyrie wird als Wechselgesang gesungen. Es erfordert also einen Vorsänger oder eine Schola.
Kommuniongang
Die Eucharistiefeier zielt auf die Begegnung mit Jesus in den Gestalten von Brot und Wein. Damit bleibt der Gläubige jedoch nicht bei Jesus stehen, sondern wird in die Beziehung Jesu zum Vater hineingenommen. Da die Eucharistiefeier im Kommuniongang ihren Höhepunkt erreicht, muss dieser auch ausgestaltet werden. Wie jede Prozession ist auch der Kommuniongang in der römischen Liturgie durch einen Wechselgesang unterlegt. Der Communiovers der Gregorianik soll eigentlich auf dem Weg zum Kommunionempfang gesungen werden. Das konzentriert die Aufmerksamkeit, denn das sich Anstellen und das langsame Vorrücken zum Chorraum kann auch von dem Entscheidenden ablenken. Ein gesungener Vers nimmt auch die gedrückte Stimmung von der Gemeinde. Die Liturgie, wie sie sich nach dem II. Vatikanischen Konzil in Afrika entwickelt hat, ermöglicht durch die Musik ein Schreiten zum Altar. Weil der Kommuniongang oft in ein Trotten oder Stolpern gerät, erhält die Reinigung der Gefäße dann leicht eine Betonung, die eigentlich dem Kommuniongang nicht gebührt. Wenn es nicht möglich ist, durch den Gesang den Kommuniongang in seiner Bedeutung zu inszenieren, dann kann eine Kommunionmeditation während der Kommunionausteilung die Konzentration der Gläubigen unterstützen. Für die Inszenierung ist wichtig, wann der Zelebrant mit der Altargruppe die Kommunion empfängt. Er teilt zwar wie Jesus das gewandelte Brot aus und reicht den Kelch, jedoch ist er genauso wie die anderen Empfangender. Sieht er sich in der Rolle des Gastgebers, der erst nach den Gläubigen kommuniziert, setzt er noch einmal eine Handlung, die die Gläubigen ja offensichtlich sehen sollen. Für die Gläubigen hat die Eucharistiefeier jedoch mit dem Empfang des Brotes ihren inneren Abschluss erreicht, es kann nur die Sendung in die Welt folgen. Die Dramaturgie der Messe läuft so, dass die Gaben vom Altar zu den Gläubigen gebracht werden und damit ihr Ziel erreichen. Noch mehr als der Kommunionempfang des Zelebranten nach den Gläubigen stört die Reinigung der Gefäße auf dem Altar den Ablauf. Diese sollte eigentlich nach Abschluss der Feier oder zumindest an der Seite geschehen. Der Zelebrant sollte damit nicht befasst sein, sondern dies den Kommunionhelfern überlassen. Er singt, weil er auch Empfangender ist, das Danklied mit und leitet dann den Abschluss der Feier ein, in der auch Ankündigungen für die kommende Woche ihren Platz haben können.
Kirchenlied
Das protestantische Erbe achten Das Kirchenlied ist nicht aus der mittelalterlichen Liturgie entstanden, sondern aus den Krippen- und Osterspielen. Im evangelischen Gottesdienst hat es einen herausgehobenen Platz, so sind auch die schönsten Kirchenlieder in der Zeit der Reformation entstanden. Die Kirchenlieder „funktionieren“ in einer Eucharistiefeier nicht einfach, wenn sie zu einer liturgischen Handlung gesungen werden. Sie müssen als eigener Teil gesehen werden, damit die Singenden sich auf die Inhalte einlassen können. Ein Begleitlied zur Gabenbereitung sollte es nicht geben, stattdessen einen Begleitgesang zum Gabengang. Dagegen verträgt die Meditation nach der Kommunion die Konzentration auf ein Lied. Das ist vor allem dann möglich, wenn die Gemeinde nicht durch die Kelchreinigung abgelenkt wird. Diese sollte nach der Messe erfolgen. Das katholische Kirchenlied hat seinen Platz eher in den Andachten, der liturgische Gesang ist ein Wechselgesang.
Hochgebet
Das eucharistische Hochgebet Das zentrale Gebet der Messfeier beginnt mit der feierlichen Einladung Zelebrant: Erhebet die Herzen! Gemeinde: Wir haben sie beim Herrn. Zelebrant: Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott! Gemeinde: Das ist würdig und recht. Danken, „eucharistein“ ist das zentrale Thema. Der Dank gilt Gott, dem Vater für seinen Sohn, dessen Werk der Erlösung und dafür, dass sich die Erlösung auswirkt, z.B. die Menschen zum Glauben und zur Nächstenliebe bewegt. Es zeigt sich, dass die Funktion der Predigt vor allem darin liegt, die Menschen auf den Dank im Hochgebet vorzubereiten. Die Gemeinde drückt das im Gesang des Sanctus aus, der vom Dank in das Preisen Gottes hinüberführt. An den Wortgottesdienst knüpft im Hochgebet die Anamnese an, die Erinnerung an die wichtigsten Stationen des Lebens Jesus, Tod und Auferstehung. Es bleibt jedoch nicht bei der Erinnerung, sondern die Gemeinde richtet ihren Blick auf die Wiederkunft Christi, wenn er die Geschichte der Menschen zu einem guten Ende führen wird. Da eine Eucharistiefeier im Kontext der Gesamtkirche gefeiert wird, stellen die Bitten für den Papst und den Ortsbischof die Verbindung zu den anderen feiernden Gemeinden her. Wie bei jedem Festmahl, z.B. im Zusammenhang mit einer Geburtstagsfeier, werden auch Bitten ausgesprochen. Die Gemeinde gedenkt der Verstorbenen und bittet für die Lebenden. Im dramaturgischen Gerüst der Messe ist das Hochgebet auf eine größere Feierlichkeit hin angelegt, die der Wortgottesdienst bereits durch das Halleluja anklingen lässt. Das Hochgebet steht in einem inneren Bezug zum Wortteil der Messe, denn hier wurde die Gemeinde vorbereitet, Gottes Wege neu zu entdecken und das Überraschende der Erlösung zu erkennen: Das Kreuz war ein notwendiger Durchgang, aber es ist nicht das letzte Wort. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt, er ist für alle der „Erstgeborene“ der Toten, in ihm ist jedem Menschen die Auferstehung des Leibes verheißen. Gott wird alle Wunden heilen – auch wenn der Lauf der Welt dem mit jeder Nachrichtensendung zu widersprechen scheint. Es ist verständlich, dass die Gläubigen nicht aus dem Stand in das Lob Gottes einstimmen können, sie brauchten die „Arbeit“ an den Problemen, die im Wortgottesdienst geleistet werden muss. Es zeigt sich deutlich, dass das Gewicht des Hochgebetes geschwächt wird, wenn die Messe bereits mit einem Überschwang an Erlösungsgewissheit begonnen wird. Diese hat ihren Platz im Hochgebet.
Hochzeit
Die Dramaturgie der Hochzeitsfeier 1. Die Schwelle zur Liturgie überschreiten Die Brautmesse beginnt nicht am Altar, sondern am Westeingang der Kirche. Der Vater führt die Tochter in die Kirche und übergibt sie damit dem Prozess, den die Liturgie gestaltet. Wenn Eltern dabei nicht von Emotionen bewegt sind, muss der Zelebrant skeptisch werden und das Thema deutlich ansprechen: für die Eltern ändert sich mit dem heutigen Tag Entscheidendes. Beobachtet er Emotionen, dann genügen der Ritus und die im Trauformular vorgesehenen Texte und Gebete. Der Gang zum Altar ist notwendig, damit sich alle Beteiligten auf den Übergang in die neue Realität vorbereiten und am Altar dann bereit sind, den Übergang zu vollziehen, den die Feier bewirken soll. 2. Bearbeitung der Krise In den meisten Liturgien wird die Krise dadurch bearbeitet, dass verlesene Texte nicht einfach exegetisch erklärt, sondern auf die an der Liturgie Teilnehmenden hin ausgelegt werden. Bei der Hochzeit zielt die Auslegung auf die neue Realität. Es genügt dabei nicht, sich nur an das Brautpaar zu wenden. Die Hochzeit vollzieht sich aus gutem Grund im öffentlichen Raum der Kirche und nicht in einem Hinterzimmer. Auch wenn die ganze Gemeinde nicht dabei sein muss, ein Paar, das im Raum der Kirche sich das Sakrament der Ehe gespendet hat, gilt dann auch außerhalb der Kirche als „verheiratet“. Das kann dann auch in der Zeitung angezeigt werden. In der Auslegung müssen die Eltern, Geschwister und die Freundeskreise der Brautleute angesprochen werden, indem sie eingeladen werden, die neue Realität auch zu wollen und so die Partnerschaft der beiden nicht zu bekämpfen, sondern zu achten und ihre Beziehung zu den Brautleuten so umgestalten, dass jetzt zur Ehefrau der Ehemann, zum Ehemann die Ehefrau gehört. Man muss jetzt beide in das bisherige Beziehungsgefüge nehmen, ob man Freundin der Braut ist oder Mutter des Bräutigams. 3. Lösung der Krise Die Krise wird durch das Jawort der Brautleute gelöst. Wenn hier starke Emotionen bei den Eltern der Brautleute, den Geschwistern und im Freundeskreis deutlich werden, ist das gut, denn es zeigt, dass der Ritus wirkt. Bedenklich wird es, wenn jemand während der Zeremonie aus der Kirche hinausgeht. Wichtig ist, dass der Zelebrant das Brautpaar allen als verheiratet vorstellt. 4. Die Lösung feiern Der Ritus, der die Bewältigung der Krise feiert, kann in der Eucharistie bestehen. Das Brautpaar wird dann durch den Kommunionempfang besonders herausgehoben und damit feierlich, nicht mehr einzeln, sondern als Paar, Mitglied der Gottesgemeinde. Dabei sollte es jedoch nicht bleiben. Wichtig ist das Foto, nicht nur des Paares, das die Kirche verlässt, sondern mit den Eltern und Geschwistern und dann möglichst mit der ganzen Hochzeitsgesellschaft. Um die Lösung zu feiern, wird in allen Kulturen ein feierliches Essen veranstaltet. Da das Hochzeitsessen zum Ritus gehört, kommt es auf bestimmte Elemente an. Folgendes muss beachtet werden: Wenn die für das Essen festgelegte Sitzordnung die Verwandten und Freundinnen der Braut von denen des Bräutigams trennt, wird die Liturgie, die in der Kirche die neue Realität hervorgebracht hat, wieder rückgängig gemacht. Die Familien und Freundeskreise müssen sich vermischen, denn die Hochzeit bewirkt, dass aus zwei Familien eine neue wird. Wenn die Freundeskreise bei der Hochzeitsfeier nicht verschmelzen, führt das dazu, dass demnächst entweder nur der Freundeskreis der Frau oder der des Mannes im neuen Haus ein- und ausgeht und Einladungen nur innerhalb des einen Freundeskreises ausgesprochen werden. Dann ist die Krise nicht voll bewältigt. Wenn einer der Eheleute seinen Freundeskreis „opfern“ muss, ist das nicht nur ein unnötiges, sondern ein schädliches Opfer. Gerät die Ehe in die Krise, verschärft sich der Konflikt, wenn einer sich plötzlich alleine dem anderen Partner mit seinem Freundeskreis gegenüber gestellt sieht. Wenn einer der Partner geschwächt in den Konflikt gehen muss, lässt sich der Konflikt viel schwerer bearbeiten, als wenn beide sich gleich stark fühlen können. Die Ars Celebrandi besteht also im Kern darin, die Krise zu bearbeiten und sie in einem Ritual zur Lösung zu führen. Dabei kann sich der Zelebrant an den 4 Schritten orientieren, durch die praktisch jeder Ritus die Beteiligten führt.
Himmlische Liturgie
Die feiernde Gemeinde, die sich in der Kirche versammelt, befindet sich symbolisch bereits im Vorhof des himmlischen Jerusalems. So sind die Kirchen gebaut. Die Apsis und die Gewölbe symbolisieren den Himmel. Die Barockkirche stellt als zentrales Motiv des Hauptaltars in der Regel die Aufnahme Marien in den Himmel dar. Das Deckengemälde über dem Kirchenschiff ermöglicht den Gläubigen einen Blick in den Himmel. In gotischen Kirchen sind die Heiligen und die Engel, Bewohner der himmlischen Welt, in den Figuren und den lichtdurchstrahlten Fenstern anwesend. Im Gesang vereinigt sich die im Kirchenraum versammelte Gemeinde mit der himmlischen Liturgie, wie sie in dem letzten Buch der Bibel, der Geheimen Offenbarung, beschrieben wird. Die Liturgien des Ostens sind von der Verschränkung der auf Erden gefeierten Liturgie mit der himmlischen Liturgie noch stärker durchdrungen. Seitdem die Aufklärung das Denken und Fühlen der Menschen im Abendland prägt, ist die Liturgie stärker auf diese Welt ausgerichtet und wird weniger als „Vorspiel“ der himmlischen Liturgie gefeiert. Im Sanctus ist diese Verschränkung von irdischer und himmlischer Liturgie noch am deutlichsten erhalten, ebenso im Gedächtnis der Heiligen. Der Zelebrant kann das Ineinander von Erde und Himmel dadurch zum Ausdruck bringen, dass er nach oben blickt und dass er in mittelalterlichen und barocken Kirchen die gebaute himmlische Dimension einbezieht, z.B. in der Eröffnung, in der Predigt oder bei der Einleitung des Vaterunsers.
Gloria
Der Gloriagesang erweitert an Festtagen wie an Sonntagen den Kyrie-Ruf. Das Gloria kann eigentlich nur gesungen werden. In der Advents- und Fastenzeit entfällt das Gloria. Das Gloria ist ein Hymnus der frühen Kirche, der in Anlehnung an die Psalmen gedichtet worden ist. ?
Gabengang und -bereitung
Nach den Fürbitten, nach denen eine Wort-Gottes-Feier mit dem Vaterunser und dem Segen abgeschlossen werden könnte, beginnt in der Messe noch einmal ein neuer Teil, der die Begegnung mit Jesus im Wort durch die Begegnung mit dem auferstandenen Christus in den Gestalten von Brot und Wein vertieft . Das, was im Wortgottesdienst „erarbeitet“ wurde, nämlich die Sicht, wie Gott das Heil wirkt und wie wir in den Prozess der Erlösung eingebunden werden, wird im Eucharistieteil gefeiert. Der Vergleich mit anderen Feiern erklärt das. Denn auch wenn bei einem Empfang die Teilnehmenden mit einem Glas Sekt begrüßt werden, wird erst der Inhalt der Feier durch Reden, eine Diashow und anderes besprochen, ehe das Buffet eröffnet wird. Die römische Liturgie gestaltet den Übergang zum eucharistischen Teil der Messe durch einen Gabenprozession, die die Gläubigen durch ein Lied begleiten. Dieses sollte ebenso wie die Kollekte beendet sein, wenn der Priester die Gebete über die Gaben spricht. Wie das Hochgebet müssen auch die Gebete über die Gaben von den Gläubigen mit vollzogen werden und dürfen daher nicht durch ein Lied überdeckt werden.
Evangeliumsprozession
Das Halleluja als Begleitgesang zur Evangelienprozession Auf einen Text aus den vier Evangelien läuft der Wortgottesdienst zu, denn in den Evangelien finden sich die überlieferten Worte und Begebenheiten des Lebens Jesu. Nicht die Predigt, sondern das Evangelium ist daher der Höhepunkt des Wortteils der Eucharistie-und anderer Feiern. Das wird durch die Evangelienprozession inszeniert, zu der begleitend der Hallelujavers vorgesungen, wiederholt und durch inhaltliche Verse ergänzt wird. Mit dem Halleluja wird Christus, ähnlich wie mit dem Kyrie, gepriesen. Die Evangelienprozession sollte so lange dauern, wie das Halleluja erklingt, also nicht nur einige Schritte im Altarraum umfassen. Anders als eine Lesung wird das Evangelium feierlich eingeleitet. Wenn Weihrauchverwendet wird, wird das Evangeliar mit Weihrauch inzensiert.
Eingangslied und Vorspiel
Das Vorspiel gehört vor den Beginn des Einzugs Wenn das Eingangslied nicht in gut protestantischer Tradition als Meditation gestaltet ist und den Wortgottesdienst thematisch einstimmt, ist das Eingangslied Begleitung zur Eingangsprozession. Es endet dann mit dem Ankommen der Altargruppe im Altarraum. Wenn die Eingangsprozession unter dem Turm beginnt, können zwei bis drei Strophen gesungen werden. Der gemeinsame Gesang baut zu Beginn ein Gefühl der Zusammengehörigkeit auf. Entscheidend ist jedoch nicht das Lied, sondern die Begrüßung Jesu, der im Vortragekreuz und dem hoch gehaltenen Evangeliar symbolisch in die Kirche einzieht. Das Vorspiel stammt aus protestantischer Tradition und hat seinen Platz vor dem Beginn des Gottesdienstes. Wird die Tradition befolgt, kommen viel weniger Menschen zu spät, sondern sind bereits konzentriert, wenn der Gottesdienst mit dem Einzug beginnt. Dann sind Musik und Ritual gut aufeinander abgestimmt, wenn mit Erreichen des Vorstehersitzes der Priester sofort die Begrüßung aussprechen kann.
Dramaturgie
Wie gelingt es, dass Menschen über 50 Minuten und länger einem Geschehen aufmerksam folgen? Ob Film, Theater, Musik oder eine Schulstunde, die jeweils zutreffende Dramaturgie sichert die Aufmerksamkeit. Der Regisseur setzt die Dramaturgie um. In gewissem Sinn ist der Zelebrant auch Regisseur. Allerdings muss er dem Aufbau des ganzen Drehbuchs folgen und innerlich das Ganze umfassen. Denn wenn der Zelebrant geistig nur jeweils beim einzelnen Teil der Feier ist, dann bekommen die Feiernden das Gefühl: „Er weiß gar nicht, wie es weiter geht. Hoffentlich findet er die richtige Stelle im Messbuch, dass die Liturgie nicht ins Stocken kommt.“ Vermittelt der Zelebrant nicht, dass er das Ganze im Blick hat, werden die Menschen vom Liedsingen, vom Zuhören, vom Antworten abgelenkt. Sie sollen sich aber ganz dem Kyrieruf, dem Text der Lesung, dem Hochgebet, dem Vaterunser widmen können. Das können sie aber nur, wenn der Zelebrant das Gefühl gibt, dass er mit ruhiger Hand die Feiernden durch die Liturgie führt. Wenn die Liedeinsätze zögerlich ausfallen, wenn die Antworten nicht einheitlich folgen, wenn die Gemeinde beim Vaterunser ins Stocken kommt, dann könnte es sein, dass der Zelebrant unaufmerksam war und den Blick für das Ganze verloren hat. Zum Höhepunkt führen Man kann von einer Dramaturgie sprechen, wenn es Bewegung gibt. Bliebe ein Gottesdienst jeweils auf der gleichen Höhe der Emotion und der inneren Beteiligung, könnte man nicht von Dramaturgie sprechen. Das Rosenkranzgebet ist für ein Gebet ohne Höhepunkt deshalb ein Beispiel, weil es ins Meditieren führen soll. Die Messe hat jedoch einen Höhepunkt. Dieser kann nicht am Anfang liegen, denn dann würde der Spannungsbogen im Verlauf des Gottesdienstes immer mehr abflachen. Dann würden die Teilnehmer nach und nach die Kirche verlassen. Damit Gottesdienstbesucher aber bleiben, muss der Zelebrant eine Erwartung aufbauen, ohne diese aber gleich am Anfang zu erfüllen. Das wird nicht selten gemacht, z.B. „Wir fragen uns: Hat Gott uns erlöst? Die Frage stellen wir mit Recht, denn als sündige Menschen brauchen wir Vergebung. Die Antwort lautet: Ja, Gott hat uns erlöst.“ Wer gleich am Anfang die zentralen Aussagen platziert, kann nicht mit der Aufmerksamkeit und inneren Beteiligung der Gottesdienstbesucher über die ganze Strecke es Gottesdienstes rechnen. Das ist auch psychologisch nicht möglich, denn das Thema der Messe heißt „Verwandlung“. Da braucht es mehr als ein paar Sätze. Der kunstvolle Aufbau der Messe beinhaltet Jahrhunderte alte Erfahrung, die nicht einfach „modernisiert“ werden können. Ihre Dramaturgie bestimmt sich einmal durch den Inhalt. Der Inhalt ist mit dem Wort “Wandlung“ umschrieben. WandlungDie Feiernden sollen sich wandeln, vom Nicht-Glauben-Können zu einem tieferen Verstehen der Heilswege Gottes, vom Schuldigen zu dem, dem Gott verziehen hat, von dem, der nicht der Bergpredigt gefolgt ist, weil die Gesetze der Welt dem Gesetz Christi widersprechen und er deshalb den Gesetzen der Welt folgen, zu einem, der den Weg Jesu wieder gefunden hat. Dieser Inhalt muss eine Form finden, damit er sich entfalten kann. Die Messe als inszenierte HandlungWelche Form hat die lateinische Liturgie gefunden, innerhalb derer die Wandlung sich vollzieht? Viele Liturgen nehmen an, die Form der Messe sei das Mahl. Das gilt für Gruppenmessen, bei denen man um einen Tisch sitzt, und z.B. weder beim Evangelium noch beim Hochgebet aufsteht und das gewandelte Brot und den Becher herumreicht. Anders die lateinische Messe. Sie hat als äußere Grundstruktur die Prozession als liturgisches Stilmittel aufgegriffen. Auch orthodoxe Liturgien kennen verschiedene Prozessionen. Dass die Prozession das grundlegende Darstellungsmittel ist, liegt an der Basilika. Sie ist so angelegt, dass vorne jemand sitzt, zu dem man hingeht, um eine Erlaubnis, ein Dokument, einen Richterspruch zu erlangen. War es in der römischen Basilika der Vertreter des Kaisers, so empfängt in der Basilika unter dem Bild Christi in der Aspis der Zelebrant die Gläubigen. Jedoch gibt es nicht nur eine Prozession. Der Zelebrant kann die Teilnehmenden am leichtesten durch die Liturgie führen und die Aufmerksamkeit gewinnen, wenn er die Stilmittel des lateinischen Ritus einsetzt: Die vier Prozessionen zum Eingang, zum Evangelium, der Gabenbereitung und zur Kommunion „funktionieren“, denn sie ermöglichen Aufmerksamkeit und Mitfeier. Die Prozessionen sind theologisch nicht notwendig, denn sonst wäre eine Gruppenmesse, die näher an der Situation im Abendmahlsaal angesiedelt ist, nicht möglich. Dramaturgisch entfaltet sich eine Messe jedoch in einer abendländischen Kirche durch die Ausgestaltung der Prozessionen. Das gilt auch für meisten nach dem Zweiten Weltkrieg gebauten, gefeiert wird. MusikEin wichtiges Element jeder Liturgie ist der Gesang. Er sollte, wie es für große Versammlungen sinnvoll ist, in der für die lateinische Liturgie gefundenen Form als Wechselgesang inszeniert werden. Es widerspricht dem Aufbau der Liturgie und der Raumkomposition, wenn die Musik von der Empore erklingt. Eine kleine Orgel im Chorraum ist sehr viel funktionaler als eine, die von hinten die Gemeinde „beschallt“. Der Wechselgesang kann, wie beim Stundengebet, zwischen zwei Gruppen, „Chören“ genannt, erfolgen, oder durch einen Vorsänger oder eine Schola, die die musikalisch schwierigeren Teile übernehmen. Die Gemeinde singt die einfacheren Teile. Das heute gängige „Kirchenlied“ hat in der römischen Liturgie eigentlich kaum Platz. Denn hier sind der Kyrieruf, das Gloria, Credo, Sanctus und Agnus Die eigentlich als Wechselgesänge konzipiert. HymnenGesungener Lobpreis und Dank hat im Gloria und der Präfation seinen Platz. Nach dem Kommunionempfang folgt ein Danklied. LesungenEin weiteres Element der Messfeier wie auch aller anderen Riten sind Lesungen aus der Bibel. Diese Tradition konnten die Christen bereits aus dem Synagogengottesdienst übernehmen. Die Lesungen werden durch Wechselgesänge gegliedert. Die Lesung des Evangeliums wird durch eine besondere Prozession, zu der das Halleluja gesungen wird, herausgehoben. GebeteZu jedem Gottesdienst gehören notwendig Gebete, mit denen Gott angesprochen wird. Mit dem Tagesgebet richtet sich die Gemeinde auf Gott, den Vater aus. In den Fürbitten wie auch in den letzten gebeten des Hochgebets werden Gott verschiedene Anliegen entgegengebracht. Weiter sind Lob und Dank Inhalte des Gebetes. Im Hochgebet und nach der Kommunion geht die Bitte dahin, dass sich in jedem vollzieht, was im Gottesdienst gefeiert wird. Die das Ganze umfassende DramaturgieDie verschiedenen Elemente machen aus einer Versammlung erst eine Liturgie. Mit Prozession und Hymnus erreicht die Versammlung erst einmal den Status einer Feier. Die Inhalte der Feier werden in Gebeten, Lesungen und der Predigt entfaltet. Die hier aufgezählten Elemente sind notwendig, sie brauchen jedoch eine Ordnung. Diese findet sich in der grundlegenden Bewegung vom Westen her zum Altar hin. Lesungen, die auf die Situation des Gottesdienstbesuchers hin ausgelegt werden, die Gesänge, Prozessionen und auch das Hochgebet bereiten auf die Begegnung mit Christus im der letzten Prozession, dem Kommuniongang vor. Deshalb ist der Höhepunkt der Messe nicht die Wandlung mit dem Hochgebet, sondern der Empfang des gewandelten Brotes. Damit ist die Dramaturgie jedoch noch nicht an ihrem Endpunkt angekommen. Denn anders als ein Krimi endet die Messe nicht, wenn der Falls „gelöst“ ist. Nach dem Krimi kann man sich ruhig zurücklehnen, nach der Messe ist das Zeugnis in der Welt gefragt und ein Handeln entsprechend dem neuen Gesetz, das Jesus verkündet hat. Es ist gerade diese Grundstruktur, die den Weg nach vorne zum Kommunionempfang durch verschiedene Elemente gliedert und dann in die Sendung zurück in die Welt mündet, die die Prozession über Jahrhunderte als Grundstruktur der Messe erhalten und den Großteil der abendländischen Kirchbauten bestimmt hat.
Beziehung zu Gott
Ars celebrandi ist die Kunst, eine Liturgie zu leiten. Es ist eine Kunst, keine Wissenschaft. Deshalb wird hier ein kleines Kompendium vorgelegt, wie diese Kunst umzusetzen ist. Die Liturgiekunst bezieht den Raum ein, strukturiert die Zeit, innerhalb derer die Liturgie gefeiert wird, und nutzt die Künste, vor allem die Musik. Der Raum wird in der römischen Liturgie durch Prozessionen gestaltet. Die Gestaltung der Zeit ist Sache einer Dramaturgie. Die Musik gewinnt ihre dramaturgische Funktion vor allem durch den Wechselgesang. Entscheidend für die Kunst, Liturgie zu feiern, ist die Rolle der Teilnehmenden. Sie sollen nicht in der Zuschauerrolle bleiben, sondern durch tätige Teilnahme, actuosa participatio genannt, selbst zu Akteuren werden. Die Liturgie ist ein Kunstwerk, das die Beziehung des Menschen zu Gott zum Thema hat. In der Liturgie tritt der einzelne nicht für sich vor Gott, sondern in der Gemeinschaft des Volkes Gottes, in das er vom Geist Gottes geführt wurde. Dass hier von einer Kunst gesprochen wird, soll die Vorbehalte gegen die Liturgie, die das II. Vatikanische Konzil konzipiert hat, aufheben. Die Sehnsucht nach der Tridentinischen Messe rührt ja wohl nicht von etwaigen Mängeln der neuen Liturgie, die sich an die Grundstruktur der römsichen Messe gehalten hat, sondern dass die Liturgie durch die Art ihrer Zelebration ihrer Feierlichkeit beraubt wurde. Offensichtlich ist der große Atem, der die römische Liturgie und die für sie gebauten Kirchenräume durchweht, ins Stottern geraten. Eine Ars celebrandi, die Kunst, eine Liturgie zu leiten, braucht den weiten Blick, die Einbeziehung des Raumes durch Prozessionen, die auf die Liturgie abgestimmte Musik und die Einbeziehung der himmlischen Dimension. Dann finden auch diejenigen, die bei der reformierten Liturgie die Feierlichkeit vermissen, den weit ausgreifenden Bogen wieder, der den Menschen nicht im Alltag verkümmern lässt.