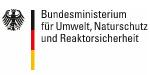Kopie von `BMU - Klimaschutz: Glossar`
Die Wörterliste gibt es nicht mehr oder die Website ist nicht (mehr) online.
Nachstehend finden Sie eine Kopie der Informationen. Eventuell ist die Information nicht mehr aktuell.
Wir weisen Sie darauf hin, bei der Beurteilung der Ergebnisse kritisch zu sein.
Kategorie: Umwelt > Klimaschutz
Datum & Land: 26/06/2010, De.
Wörter: 18
Annex-B-Länder
Der Annex B des von 1997 listet alle Länder auf, die im Rahmen des konkrete in der ersten Verpflichtungsperiode (2008-2012) übernommen haben. Auf der Liste stehen alle Annex-I-Länder plus Kroatien, Slowenien, Monaco und Liechtenstein, jedoch ohne Weißrussland und Türkei. Der Begriff "Annex-B-Länder" wird daher ebenfalls oft synonym mit "Industrieländer" benutzt, mit "Non-Annex-B-countries" sind in der Regel die Entwicklungs- und Schwellenländer gemeint.
Annex-I-Länder
Der Annex I der Klimarahmenkonvention von 1992 listet alle Länder auf, die im Rahmen der Klimarahmenkonvention die Selbstverpflichtung zur Reduktion ihre bis zum Jahr 2000 auf das Niveau von 1990 übernommen haben. Auf der Liste stehen alle OECD-Länder (außer Korea und Mexiko) sowie alle osteuropäischen Länder (außer Jugoslawien und Albanien). Der Begriff "Annex-I-Länder" wird daher oft synonym mit "Industrieländer" benutzt, mit "Non-Annex-I-countries" sind in der Regel die Entwicklungs- und Schwellenländer gemeint.
Bonner Beschluss
Der Bonner Beschluss ("Bonn Agreement") war das zentrale Ergebnis der Fortsetzung der 6. Vertragsstaatenkonferenz im Juli 2001 in Bonn. In dieser politischen Entscheidung haben die verhandelnden Minister zu allen wesentlichen Fragen der Ausgestaltung des Kompromisse geschlossen. Mit dem Bonner Beschluss ist das Kyoto-Protokoll ratifizierbar geworden. Den Text des Bonner Beschlusses finden Sie.
Clean Development Mechanism
(CDM) Der CDM ("Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung"), in Artikel 12 des festgelegt, ermöglicht es Industrie- und Entwicklungsländern, gemeinsam Klimaschutz-Projekte in den Entwicklungsländern durchzuführen. Dabei wird das Projekt (z. B. die Errichtung einer Windkraftanlage) vom Industrieland finanziert. Die hierdurch im Entwicklungsland vermiedenen Emissionen darf das Industrieland in der entweder zusätzlich emittieren oder sich als Emissionsguthaben gutschreiben lassen. Ein Teil der Finanztransfers im Rahmen der CDM-Projekte ("share of proceeds") soll in einen Fonds zugunsten der am meisten vom Klimawandel betroffenen Staaten (insb. kleiner Inselstaaten) fließen. CDM-Projekte müssen beim CDM-Exekutivrat ("Executive Board") registriert werden. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten des CDM-Exekutivrats:
Conference of the Parties
(COP) engl.: für Vertragsstaatenkonferenz
Emissionshandel
(engl.: "emissions trading") Das Kyoto-Protokoll weist allen Annex-B-Ländern für die erste eine zulässige Emissionsmenge an zu. Laut Artikel 17 des ist es erlaubt, dass Annex-B-Länder ihre Emissionsmenge selbst aufbrauchen oder Teile davon mit anderen Annex-B-Ländern handeln. Vgl. auch.
Emissionsreduktionsverpflichtungen
Im Kyoto-Protokoll sind für die erste (2008-2012) verbindliche Pflichten der Industrieländer zur Begrenzung und Minderung ihrer festgelegt. In Annex B des Protokolls ist festgehalten, dass folgende Staaten ihre bezogen auf 1990 wie folgt begrenzen: Bulgarien, Estland, alle EU-Staaten, Lettland, Litauen, Monaco, Rumänien, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Tschechien: 8%, USA: -7%, Japan, Kanada, Polen, Ungarn: - 6%, Kroatien: - 5%, Neuseeland, Russland, Ukraine: +/- 0% Norwegen: +1% Australien: +8% Island: +10% Dies bedeutet eine Gesamtreduktion der in den genannten Ländern um -5,2%. Die Staaten der Europäische Union haben in einer so genannten ihre Reduktionsverpflichtungen neu verteilt.
Erfüllungskontrolle
(engl.: "compliance") System, das die Einhaltung der Reduktionsverpflichtungen kontrolliert und Maßnahmen und Sanktionen für den Fall vorsieht, dass ein Land seinen im Kyoto-Protokoll niedergelegten nicht nachkommt.
EU-Lastenverteilung
(engl.: EU burden sharing) Die EU hat ihre gemeinsame Reduktionsverpflichtung von -8% in der ersten Verpflichtungsperiode gemäß einer EU-internen Lastenverteilung im Juni 1998 intern neu verteilt. Danach lauten die Reduktionsverpflichtungen und Emissionsobergrenzen der EU-Mitgliedsstaaten bezogen auf ihre 1990er Emissionen: Luxemburg: -28%Deutschland, Dänemark: 21% Österreich: -13% Großbritannien: -12,5% Belgien: -7,5% Italien: -6,5% Niederlande: -6% Finnland, Frankreich: +/-0% Schweden: +4% Irland: +13% Spanien: +15% Griechenland: +25%Portugal: +27%.
Flexible Mechanismen
Das Kyoto-Protokoll sieht drei Instrumente vor, die den Vertragsstaaten Flexibilität bei der Umsetzung ihrer Reduktionsziele erlauben:, (gemeinsam durchgeführte Projekte zwischen Industrieländern) und (Projekte zur Emissionsreduktion in Entwicklungsländern). Der Grundgedanke aller drei flexiblen Mechanismen ist, dass die Annex-B-Länder ihre Reduktionsverpflichtungen teilweise im Ausland erbringen können.
Globale Umweltfazilität
(engl.: "Global Environmental Facility, EF"Multilaterales Finanzierungsprogramm der Industrieländer für mweltprojekte in Entwicklungsländern. Die GEF vergibt im Rahmen der limarahmenkonvention, des Montrealer Protokolls zum Schutz der Ozonschicht und der Konvention über die Biologische Vielfalt Zuschüsse und stark verbilligte Kredite für Projekte in Entwicklungsländern. Sie verwaltet dabei u.a. die drei auf der 7. Vertragsstaatenkonferenz von Marrakesch neu eingerichteten Fonds zur Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen in Entwicklungsländern: Den "Special Climate Change Fund", den "Least Developed Countries Fund" sowie den "Kyoto Protocol Adaptation Fund". Die Internetseite des GEF finden Sie auf
Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen
(engl: United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC) Die Klimarahmenkonvention wurde auf dem Weltgipfel für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro angenommen und seither von 186 Staaten ratifiziert. Sie trat 1994 in Kraft. Die Klimarahmenkonvention ist der erste internationale Vertrag, der den Klimawandel als ernstes Problem bezeichnet und die Staatengemeinschaft zum Handeln verpflichtet. Die Konvention bildet den Rahmen für die Klimaschutz-Verhandlungen, die jeweils als Vertragsstaatenkonferenz der Konvention stattfinden. Weitere Informationen: - Das Sekretariat der Klimarahmenkonvention:
Kyoto-Protokoll
Das Kyoto-Protokoll wurde 1997 von der 3. Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention angenommen. In dem Protokoll verpflichten sich die Industriestaaten, ihre gemeinsamen Emissionen der wichtigsten im Zeitraum 2008 bis 2012 um mindestens 5% unter das Niveau von 1990 zu senken. Dabei haben die Länder unterschiedliche akzeptiert. Damit das Protokoll in Kraft treten kann, muss es von mindestens 55 Staaten ratifiziert werden, wobei diese mindestens 55% der CO2-Emissionen der Annex I-Länder von 1990 auf sich vereinigen müssen. Deutschland hat gemeinsam mit den anderen EU-Mitgliedsstaaten das
Senken
Ein Ökosystem, das Kohlenstoff aus der Atmosphäre entfernt, ist eine Senke (so entnimmt etwa ein Baum im Laufe seiner Wachstumsphase der Atmosphäre Kohlenstoff). Teil des Kompromisses der Vertragsstaaten im war, dass die Kohlenstoffeinbindung in Senken bis zu gewissen Grenzen auf die angerechnet werden können.
Treibhausgase
Gase in der Atmosphäre, die die Wärmerückstrahlung von der Erdoberfläche in das All verhindern, die natürliche Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre sorgt dafür, dass auf unserem Planeten statt eisiger Weltraumkälte eine durchschnittliche Temperatur von 15°C herrscht. Der zusätzliche Ausstoß von durch menschliche Aktivitäten heizt das Klima jedoch weiter auf und hat einen zur Folge, der schwerwiegende Folgen mit sich bringen kann (u.a. Anstieg des Meeresspiegels, Verschiebung der Klimazonen, Zunahme von Stürmen). Das Kyoto-Protokoll sieht daher eine Emissionsreduktion für die wichtigsten Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N20), teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (H-FKW, engl.: HFC), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW, engl.: PFC) und Schwefelhexafluorid (SF6) vor.
UNFCCC-Sekretariat
Das Sekretariat der Klimarahmenkonvention hat seit 1996 seinen Sitz in Bonn und ist dort die größte Teilorganisation der Vereinten Nationen. Ca. 150 Mitarbeiter bereiten fachlich und organisatorisch die Vertragsstaatenkonferenzen und andere Expertentreffen vor, auf denen internationale Entscheidungen zum Klimaschutz vorbereitet bzw. verabschiedet werden. Zur Homepage des Sekretariats
Verpflichtungsperiode
Um den Vertragsstaaten Flexibilität bei der Erfüllung der Kyoto-Verpflichtungen einzuräumen und den Einfluss vorübergehender Emissions-Schwankungen zu minimieren, werden die en auf einen Fünfjahreszeitraum angewandt. Die erste geht von 2008 bis 2012. Über weitere soll laut Kyoto-Protokoll spätestens ab 2005 verhandelt werden.
Vertragsstaatenkonferenz
Das höchste Gremium der von 1992, das laut Konvention einmal jährlich tagt. Nach dem Inkrafttreten der 1994 fand die erste Vertragsstaatenkonferenz (COP 1) 1995 in Berlin statt. Es folgten 1996 Genf (COP 2), 1997 Kyoto (COP 3), 1998 Buenos Aires (COP 4), 1999 Bonn (COP 5), 2000 Den Haag (COP 6), im Juli 2001 Bonn (COP 6bis) als Fortsetzung der in Den Haag unterbrochenen Konferenz, im November 2001 Marrakesch (COP 7), 2002 Neu Delhi (COP 8), 2003 Mailand (COP 9), 2004 Buenos Aires (COP 10), 2005 Montreal (COP 11), 2006 Nairobi (COP 12) 2007 Bali (COP 13), 2008 Poznañ/Posen (COP 14), 2009 Kopenhagen (COP 15).