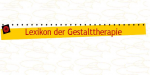Kopie von `Lexikon der Gestalttherapie`
Die Wörterliste gibt es nicht mehr oder die Website ist nicht (mehr) online.
Nachstehend finden Sie eine Kopie der Informationen. Eventuell ist die Information nicht mehr aktuell.
Wir weisen Sie darauf hin, bei der Beurteilung der Ergebnisse kritisch zu sein.
Kategorie: Mensch und Gesellschaft > Gestalttherapie
Datum & Land: 07/04/2009, De
Wörter: 56
Würdigung
Etymologie: Das althochdeutsche Wort »wirdi« bedeutet so viel wie Ehre, Ansehen und ist mit »Wert« verwandt. Verwendung in der Gestalttherapie: Heilung in der Gestalttherapie geschieht durch die Würdigung: Der Klient kommt zum Therapeuten, weil er mit einem Lebensproblem meint, nicht mehr allein fertig werden zu können. Vorsichtig lässt ihn der Th...
Wohlwollen
Etymologie: Lehnübersetzung im 16. Jahrhundert aus dem lateinischen »benevolentia« (wörtlich: guter Wille). Da »wohl« auch zum Wortumfeld von »wollen« gehört (z.B. Wollust), handelt es sich eigentlich um eine Verdoppelung. Verwendung in der Gestalttherapie: Gestalttherapeuten gehen davon aus, dass ein »Symptom« (ein Problem, eine »Macke«, eine Neu...
Wilhelm Reich
Lebensdaten: Geboren 1897 in Dobrzcynica (Galizien), gestorben 1957 in Lewisburg (Pennsilvania, USA). Zunächst Psychoanalytiker im Umkreis Sigmund Freuds. Indem er die Qualität des sexuellen Erlebens (»orgastische Potenz«) ins Zentrum seiner psychotherapeutischen Anstrengungen stellte, wurde er von Freud geächtet, eine Kränkung, die Reich zeitlebe...
Wirklichkeit
Etymologie: Der Begriff ist von dem deutschen Mystiker Meister Eckhardt zu Beginn des 14. Jahrhunderts geprägt worden. Er soll die Starre und Passivität des Wahrheitsbegriffs überwinden und das Prozesshafte des Zur-Wahrheit-Bringens durch Wirken, durch tätiges Handeln betonen. Allerdings ist dies kein gedanklicher Bruch zur philosophischen Traditi...
Widerstand
Etymologie: Das Wort »wider« ist synonym mit »gegen«, sodass »Widerstand« usprünglich das Gleiche bedeutete wie »Gegenstand«, nämlich »Entgegenstehendes« oder »Hemmendes«. »Gegenstand« ist im Laufe des 18. Jahrhunderts als eine Eindeutschung für »Objekt« gebräuchlich geworden, während »Widerstand« den ursprünglichen Sinn behielt. Bedeutung für die...
Wahrnehmung
Etymologie: Der umfangreiche Wortstamm »wa(h)r« hat die z.T. widersprüchlichen Bedeutungen von Sein (Wahrheit), Glauben (Wahn, Wahnsinn), sichern, behüten, schützen (bewahren, verwahren) und zugestehen (gewähren) sowie erinnern. Das Verb »wa(h)ren« hat zusätzlich die Bedeutungen von sehen (gewahren, wahrnehmen) und in Acht nehmen (warnen). »Wahrne...
Wachstum
Etymologie: Wachsen ist ein altes indogermanisches Verb, das ein Größerwerden infolge organischer Entwicklung bedeutet, zunächst beschränkt auf Pflanzen. In einem übertragenen Sinne gilt »wachsen« auch von Mineralien. Die negative Bedeutung eines überstarken, schädlichen Wachstums ist in »wuchern« übergegangen. – Die Abstraktion zu »Wachstum« find...
Unterstützung
Englisch »support«. Die Gestalttherapie geht davon aus, dass das »Symptom«, die »Krankheit«, die »Neurose« eine kreative Antwort des Klienten auf sein Problem darstellt. Ihm in dieser, also in einer unveränderten Situation sein Symptom, seine Krankheit oder seine Neurose »wegzutherapieren« würde, selbst wenn es gelingen sollte, so wirken, als würd...
Topdog
Die Begriffe »Topdog« und »Underdog« benutzte Fritz Perls, um komplexe psychische Vorgänge auf eine einfache Weise darzustellen. Die Begriffe stammen aus der Holzfällersprache: Um mächtige Bäume zersägen zu können, wird unter dem gefällten Baum ein Loch gegraben. Der Topdog steht oben, der Underdog befindet sich in der Grube, um gemeinsam die Säge...
Therapieziele
Etymologie: »Therapie« entstand im 18. Jahrhundert aus dem altgriechischen »therapeía« (Dienst, Pflege) und »therápon« (Diener, Gefährte). †“ Das Umfeld des germanischen Wortes »zil« bezeichnet einen räumlichen oder zeitlichen Endpunkt, hat aber auch Nebenbedeutungen wie z.B. »passend«, »sich beeilen« oder »mit Eifer tun«. Therapieziele in der Gest...
Supervision
Etymologie: Ein Kunstwort aus dem lateinischen »super« (über) und »videre« (sehen), aber nicht im Sinne vom deutschen »übersehen«, sondern von »überblicken«. Im Englischen bedeutet »to supervise« beaufsichtigen, kontrollieren und überwachen. Bedeutung für die Psychotherapie: Dass sich ein Psychotherapeut regelmäßig professioneller »Kontrolle« unte...
Simkin, James (Jim) S.
Lebensdaten: 1919-1984. Er kam schon in den frühen 1950er Jahren in Kontakt mit der Gestalttherapie. Er war einer der ersten Klienten und später Schüler von Fritz Perls in New York. Als er später nach Los Angeles zog, war er der erste Gestalttherapeut an der Westküste. Am Esalen-Institut in Big Sur, dem Zentrum der »Human-Potential«-Bewegung, ware...
Selbstregulierung
Auch: Autonomie, Eigenständigkeit, Selbstbestimmung, Selbstorganisation, Selbstregulation, Selbstständigkeit. Der Begriff bezeichnet einen Vorgang, der sich von innen her reguliert, ohne von außen gesteuert zu werden. Ein alltägliches Beispiel ist die Abschaltung der Wasserzufuhr, wenn der WC-Kasten nach Betätigung der Spülung voll ist. Durch eine...
Rogers, Carl R.
Lebensdaten: Geboren Oak Park (Illinois) 1902, gestorben La Jolla (Californien) 1987. Er entwickelte die »klientenzentrierte Gesprächstherapie« (1948) und ist Mitbegründer der »humanistischen Psychologie« (1962). Auf Rogers†™ Begriff der »Klientenzentrierung« geht zurück, dass man heute in der Psychotherapie meist nicht mehr von »Patient« spricht, ...
Retroflektion
Etymologie: Aus lateinisch »retro« (zurück, rückwärts, nach hinten) und »flexio« (Biegung). Definition: Durch Retroflektieren tut sich der Handelnde sowohl in negativer als auch in positiver Hinsicht das an, was »eigentlich« auf ein Objekt gerichtet ist. Jemand ist beispielsweise eigentlich auf jemanden anderes wütend. Seine introjizierte Norm sag...
Rank, Otto
Lebensdaten: Geboren Wien 1884, gestorben New York 1939. Er war ein enger Vertrauter von Sigmund Freud und führend in der »Psychoanalytischen Bewegung« tätig. Er beschäftigte sich intensiv mit der Kunst und dem Künstler. 1924 überwarf er sich mit Freud, weil er das »Geburtstrauma« für grundlegender als den »Ödipus-Komplex« erklärte. Er praktizier...
Projektion
Etymologie: Aus dem lateinischen Verb »proiciare« (vorwerfen, hin- und wegwerfen, verachten, verschmähen, fortjagen). Definition: Das Projizieren besteht darin, das Objekt zu leugnen oder zu negieren, es also nicht so wahrzunehmen, wie es ist. Anstelle dessen werden ihm Eigenschaften unterstellt. Das Objekt wird mit etwas eigenem (Interpretation, ...
Polster, Erving und Miriam
Lebensdaten: Erving (1922) und seine Frau Miriam Polster (1924-2001) zählen zu den bekanntesten Gestalttherapeuten der Welt. Vor gut drei Jahrzehnten veröffentlichten sie ihr Grundlagenwerk »Gestalttherapie: Theorie und Praxis der integrativen Gestalttherapie« (erweiterte Neuauflage in der Edition des Gestalt-Instituts Köln/GIK Bildungswerkstatt i...
Phänomenologie
Von Edmund Husserl (1859-1938) um 1900 begründete Schule der Philosophie. Das griechische Wort »phainomenon« bedeutet »das Erscheinende«; »Phänomenologie« heißt demnach in etwa »Erscheinungslehre« oder »Lehre von den Erscheinungen«. Unter »Phänomenologie« ist nicht zu verstehen, einfach die Dinge als Erscheinungen zu beschreiben. Vielmehr ist »Phä...
Perls, Laura
Lebensdaten: Geboren 1905 als Lore Posner in Pforzheim, gestorben daselbst 1990. Sie stammt aus einer jüdischen Juweliersfamilie. Sie hat eine Schwester und einen Bruder. Als einziges Mädchen besucht sie ein Gymnasium und fängt nach dem Abitur zunächst ein juristisches Studium an, wechselt jedoch schnell zu Philosophie und Psychologie. In Frankfur...
Paradoxe Theorie der Veränderung
Arnold R. Beisser, der diese Theorie ausformuliert hat, schreibt dazu (in: Wozu brauche ich Flügel?, 1989, dt.: Wuppertal 2003, S. 139ff): »Der Gestalttherapeut verweigert die Rolle des 'Veränderers', weil seine Strategie darin besteht, den Klienten zu ermutigen, ja sogar darauf zu bestehen, dass er sein möge, wie und was er ist. Er glaubt, dass V...
Neurose
Lexikalisch: Der Begriff wurde von dem englischen Arzt William Cullen im achtzehnten Jahrhundert aus dem griechischen »neuro« (Nerv) geprägt für die Bezeichnung aller nichtentzündlichen Nervenkrankheiten. Durch Sigmund Freud bekam er die heutige Form und meint seelisch bedingte Störungen ohne organische Ursache. Eine genauere Abgrenzung des Bedeut...
Moreno, Jakob Levy
Lebensdaten: Geboren Bukarest 1892, gestorben Beacon (New York) 1974. Amerikanischer Psychiater und Begründer des Psychodramas. Bedeutung für die Gestalttherapie: In »Das Ich, der Hunger und die Aggression« (1944) bezieht sich Fritz Perls positiv auf Moreno, weil er den Missstand überwindet, dass Freud den Klienten zum passiven Objekt der Interpre...
Mittlerer Modus
Im Altgriechischen gibt es neben dem Aktiv (»Ich beschreibe etwas«) und dem Passiv (»Ich werde beschrieben«) eine dritte Form, das »Medium« (»Ich beschreibe mich«). Im Deutschen wird dies durch die reflexiv bzw. rückbezüglich genannte Konstruktion mit »sich« gebildet. Das erkenntnistheoretisch und psychologisch Interessante am mittleren Modus ist,...
Krankheit
Etymologie: »Krank« bedeutet ursprünglich »schmal, schlank, gering, schwach, nichtig« und war ein Euphemismus für »siech« (noch heute gibt es »dahinsiechen«). »Kränken« steht für »schwach, kraftlos machen«. Problematik: Der Krankheitsbegriff ist besonders im psychischen Bereich stark umstritten, da er einen großen normativen Anteil hat. Im Zuge de...
Kontaktstörungen
Alle physischen und psychischen Probleme eines Organismus†™ bezeichnet die Gestalttherapie als Störungen im Kontakt bzw. an der Kontaktgrenze. Von manchen Autoren wird der Begriff »Unterbrechungen des Kontakts« bevorzugt, um die nicht gewollte Assoziation zu psychiatrisch diagnostizierten »Störungen der Persönlichkeit« zu vermeiden. Allerdings klin...
Konfluenz
Etymologie: Lateinisch »confluens« (Zusammenfließen). Definition: Konfluenz (manchmal werden auch die Begriffe »Verstrickung« oder »Verschmelzung«) gebraucht) bezeichnet in der Gestalttherapie die fehlenden Kontaktgrenzen gegenüber der Umwelt. Die Differenz zwischen Subjekt und Objekt werden negiert. Wer sich immer nach den Erwartungen anderer ric...
Holismus
Von Jan Christiaan Smuts (1870-1950) aus dem griechischen Wort »hólos« (»ganz«) in der Schrift »Holism and Evolution« (1925) gebildeter Begriff, der im Deutschen dem der »Ganzheitlichkeit« entspricht. Neben der Bedeutung für die Gestalttherapie wirkte Smuts†™ Holismus auf den englischen Biologen John Scott Haldane (1860-1936) und den deutschen Wiss...
Introjekt
Etymologie: Siehe unter »Introjektion«. †“ Das, was beim Introjizieren (bei der Introjektion) entsteht; das unverdaute Nahrungsmittel, das schwer im Magen liegt; der unverstandene Lehrsatz, der sinnlos »nachgebetet« wird; die aufgezwungene Regel, die zwanghaft befolgt wird. Bedeutung für die Gestalttherapie: Jeder Kontaktstörung liegt ein Introjekt...
Intervention
Etymologie: Der Begriff leitet sich ab vom lateinischen »inter-venire« für dazwischentreten, hinzukommen, unterbrechen, durchkreuzen, vermitteln. In der Außenpolitik bedeutet »Intervention« ein militärisches Eingreifen; in der Wirtschaftspolitik das staatliche Eingreifen in das Marktgeschehen. In der Psychotherapie steht »Intervention« für das the...
Introjektion
Etymologie: Ein neulateinisches Kunstwort, gebildet aus »intro« (hinein) und »iactare« (werfen). Definition: Als »Introjektion« wird in der Gestalttherapie die »unverdaute«, »unassimilierte« oder »unangepasste« Aufnahme von Nahrung, Normen usw. bezeichnet. Dinge werden »als Ganzes« geschluckt, ohne angepasst (integriert) zu werden. Introjektion is...
Jung, Carl Gustav
Lebensdaten: Geboren in Kesseil 1875, gestorben Küsnacht 1961. Schweizer Psychiater. Zunächst ein Anhänger Sigmund Freuds, aber 1912 kam es zum Bruch und Jung nannte seine Richtung zur Unterscheidung »analytische Psychologie«. Jung kritisierte den Begriff des Unbewussten bei Freud, der sich auf ein rein negativ zu bewertendes Phänomen bezieht, das...
Kontakt
Etyhmologie: Der Begriff entstand im 17. Jahrhundert aus dem lateinischen »contactus«, zu »contigere« (2. Partizip von »contactum«), was »berühren« heißt. Bedeutung für die Gestalttherapie: Kontakt ist der zentrale Begriff der Gestalttherapie. In Aristoteles†™ Schrift »Von der Seele«, die Perls, Hefferline, Goodman für »Gestalttherapie« als Hinterg...
Gestalt-Gruppentherapie
Gestalttherapie war zunächst als Einzeltherapie gedacht. Der erste Ansatz, mit einer Gruppe zu arbeiten, ergab sich in dem Ausbildungs-Setting. Menschen, die in Gestalttherapie ausgebildet werden wollten, sollten zuerst auch selbst Erfahrungen in der Klientenrolle machen, ohne (wie damals in der Psychoanalyse üblich) ausschließlich auf die Lehrana...
Gestalt-Paartherapie
In der Gestalttherapie mit Paaren geht es um zweierlei: um die Entwicklung von umfassendem Gewahrsein und die (Wieder-)Herstellung von Kontakt zwischen den beiden Partnern. »Kontakt« besteht (nach Hilarion Petzold) aus vier Stufen, die alle für ein Paar bedeutsam sind: Begegnung Berührung Beziehung Bindung Der hervorgehobene Stellenwert von K...
Gestaltausbildung
Im deutschsprachigen Bereich haben sich unterschiedliche Modelle der gestalttherapeutischen Ausbildung entwickelt. An dieser Stelle werden wir die »Gestalt-Ausbildung nach dem Kölner Modell« exemplarisch vorstellen. Grundsätzlich braucht jemand, der Gestalttherapeut werden will, ein großes Interesse am anderen Menschen und am Kontakt mit ihm. Dazu...
Gestalttechniken
Etymologie: Aus dem altgriechischen »téchne« für Hand- bzw. Kunstwerk sowie Kunstfertigkeit entsteht das im klassischen Latein wenig gebräuchliche »techna« (für List) und »technicus« (für Lehrer der Kunst); im Mittellatein ist mit »techna« Methode gemeint, und erst im 17. bzw. 18. Jahrhundert entsteht langsam die heutige Bedeutung. Zu »Gestalt« si...
Gestalttherapie
Etymologie: »Gestalt« siehe Gestaltpsychologie; »Therapie« siehe Therapieziele. Definition: An dieser Stelle der Vorschlag einer kürzest möglichen Definition: Die Gestalttherapie befasst sich mit nicht angemessenem Verhalten. Als »nicht angemessen« wird Verhalten betrachtet, mit dem der Handelnde nicht erreicht, was er erreichen will (bzw. das ihn...
Gestaltkritik
Erstmals als Titel eines Buches von Stefan Blankertz benutzter Begriff (Gestaltkritik: Paul Goodmans Sozialpathologie in Therapie und Schule, Köln 1990). Mit dem Ideal der von innen heraus geschlossenen Gestalt werden soziale und individuelle Mechanismen kritisiert, die die Gestaltschließung behindern. Heute Titel der weltweit auflagenstärksten Ze...
Gewahrsein
Etymologie: Siehe unter »Wahrnehmung«. Verwendung in der Gestalttherapie: Das Wort wird zur Übersetzung von »awareness« benutzt (in älteren Übersetzungen findet sich auch »Bewusstheit« und »Bewusstsein«). »Gewahrsein« ist aktiver als Wahrnehmung und passiver als Bewusstsein. Von Gewahrsein wird gesprochen, wenn die Wahrnehmung von dem Wissen begle...
Gegenwart
Etymologie: Das Wort setzt sich aus »gegen« (entgegenstehen) und »werden« zusammen. Ursprünglich bedeutete es die unmittlbare Anwesenheit des Gegners und die Konfrontation mit ihm, dann das Treffen mit ihm vor Gericht und bezeichnete später das sprachliche Präsens. Der Zusammenhang mit Gegnerschaft klingt noch heute in der Nebenform »widerwärtig« ...
Friedlaender, Salomo
Lebensdaten: Geboren Golancz 1871, gestorben Paris 1946. An Immanuel Kant orientierter Philosoph und unter dem Pseudonym Mynona ein humoristischer Schriftsteller. Hauptwerke: Logik: Die Lehre vom Denken (1907), Psychologie: Die Lehre von der Seele (1907), Friedrich Nietzsche (1911), Schöpferische Indifferenz (1918), Kant für Kinder: Fragelehrbuch...
Freud, Sigmund
Lebensdaten: Geboren in Freiberg (Österreich) 1856, gestorben im Londoner Exil 1939. Als Nervenarzt widmete er sich seelischen »Erkrankungen« ohne erkennbare organische Ursache, die »Hysterien« genannt wurden, und entwickelte gegenüber den damaligen unzureichenden Behandlungversuchen mit Suggestion und Hypnose die Methode der Psychoanalyse. Damit ...
Feldtheorie
Begriffsgeschichte: In der Naturwissenschaft wurde der Feldbegriff im 19. Jahrhundert zunächst entwickelt, um unmittelbare Fernwirkungen von Kräften zu beschreiben. Michael Faradays (1791-1867) Elektrodynamik benutzt den Feldbegriff dann auch, um Nahwirkungen zu beschreiben, bei denen eine Kraft nicht linear auf ein Objekt wirkt, sondern in einer ...
Existentialismus
Verstreute Hinweise einiger Begründer der Gestalttherapie (besonders Laura Perls in Interviews der 1980er Jahre) auf die Existenzphilosophie bzw. den Existenzialismus leben fort in einer vagen Kennzeichnung der Gestalttherapie als »existenzieller Therapie«. Eine genauere Betrachtung zeigt aber, dass der Bezug der Gestalttherapie zum Existenzialism...
Erfahrung
Etymologie: Das mittelhochdeutsche Verb »ervarn« bedeutet durchreisen, durchfahren, durchziehen, aber auch hören, mitgeteilt bekommen. Seit dem 15. Jahrhundert wird das Partizip »erfahren« adjektivisch für »klug, bewandert« gebraucht. Das mittelhochdeutsche Substantiv »ervarunge« steht für Wahrnehmung, »eine Lehre gezogen haben« und (empirische) E...
Demut
Etymologie: Zusammengesetzt aus dem althochdeutschen »dio« für Knecht und »muot« (Mut) für Gesinnung, Haltung. Übersetzt: »Die Gesinnung oder Haltung eines Knechts«. Diese Bedeutung kann positiv sein, z.B. als Haltung gegenüber Gott oder einem rechtmäßigen Herrn, oder negativ, z.B. als feige Unterwürfigkeit. Demut unrechtmäßig fordern heißt »demüt...
Buber, Martin
Lebensdaten: Geboren in Wien 1878, gestorben in Jerusalem 1965. Jüdischer Religions- und Sozialphilosoph. Verstand sich als religiöser Sozialist und Anarchist. Nachdem 1919 bei der Niederschlagung der Münchner Räterepublik sein Freund Gustav Landauer, ein führender Theoretiker des Anarchismus, erschlagen worden war, gab er dessen Schriften posthu...
Buddhismus
Die asiatische Lehre des Siddhartha Gautama, der als Weiser den Ehrentitel »Buddha« erhielt, entstand im fünften oder sechsten Jahrhundert v. Chr. Zentrum der Lehre ist die Vorstellung, durch ein reines (asketisches) Leben Erlösung vom Leid durch den Eingang ins Nirwana zu erlangen. Das Leid ist mit dem Sein identifiziert und das Nirwana mit dem N...
Befriedigung
Etymologie: Das Verb »befriedigen« wurde im 15. Jh. aus »Frieden« (Schonung, Freundschaft, geschützt) gebildet, dann seit dem 16. Jh. im Sinne von »zufrieden« (zu Frieden setzen, zur Ruhe bringen) verwendet. Substantivisch erst seit der deutschen Klassik gebraucht. Bedeutung für die Gestalttherapie: Der Abbau der Spannung, nachdem durch einen aggr...
Bedürfnis
Ethymologie: Der Wortstamm zu »dürfen« hat sprachgeschichtlich Bedeutungen von »sich sättigen« über »sich erfreuen« bis zu »entbehren« angenommen und erst spät den Sinn von »erlauben« erhalten. Die negativen Schattierungen sind noch heute in »dürftig« (mangelhaft) und »bedürftig« (arm) lebendig. In der modernen Psychologie wird das Wort meist gera...
Awareness
Etymologie: Das englische Adjektiv »aware« steht für »gewahr«, »bewusst«, »merken« und »Kenntnis haben von« bzw. »unterrichtet sein über«. Ältere Übersetzungen von gestalttherapeutischen Texten haben stets »Bewusstsein« oder »Bewusstheit«. Mit dem gestalttherapeutischen Begriff »awareness« ist jedoch nicht das Bewusstsein gemeint, wie es mit dem e...
Assimilation
Etymologie: Aus lateinisch »assimulatio«, Ähnlichmachung (auch im Sinne von Verstellung und Heuchelei). Bedeutung für die Gestalttherapie: Assimilation ist der »Zweck« bzw. die »Funktion« des Handelns, des Kontaktes (PHG, Band »Grundlagen«, S. 213). Umweltressourcen werden im aggressiven Prozess des Kontaktes »zerstört« und so nach Maßgabe der Bed...
Angst
Etymologie: Das deutsche Wort »Angst« entsteht aus dem indogermanischen »angh« (eng) mit dem Suffix »st« (dazugehörig), heißt also: »das, was zur Enge gehört«. Ähnlich lateinisch: »angustiae« (Enge). Definition: Wenn man im Alltag von »Angst« spricht, handelt es sich zumeist um die Vermischung von zwei Phänomenen, die getrennt werden müssen (nach ...
Aggression
Etymologie: Das Wort entstand im 18. Jahrhundert aus dem lateinischen »aggressio«. »Aggressio« setzt sich aus »gressio« (Schreiten, Schritt, Gehen) und der Vorsilbe »ad« (heran) zusammen und bedeutete »Angriff« gewaltsamer Art, wurde aber auch im übertragenen Sinne als »Angriff durch Rede« verwendet; in der Diskussion hieß es »Schlussfolgerung«; d...
Achtsamkeit
Etymologie: Die auf den indogermanischen Stamm »ok« (nachdenken) zurückgehenden Worte bewegen sich in den Bedeutungsfeldern »nachdenken«, »beachten«, »beraten«, »schätzen«, »bedenken« und »zaudern«. Bedeutung für die Gestalttherapie: Achtsamkeit ist eine wichtige Haltung des Gestalttherapeuten, die aus dem dialogischen Gedanken Martin Bubers und a...